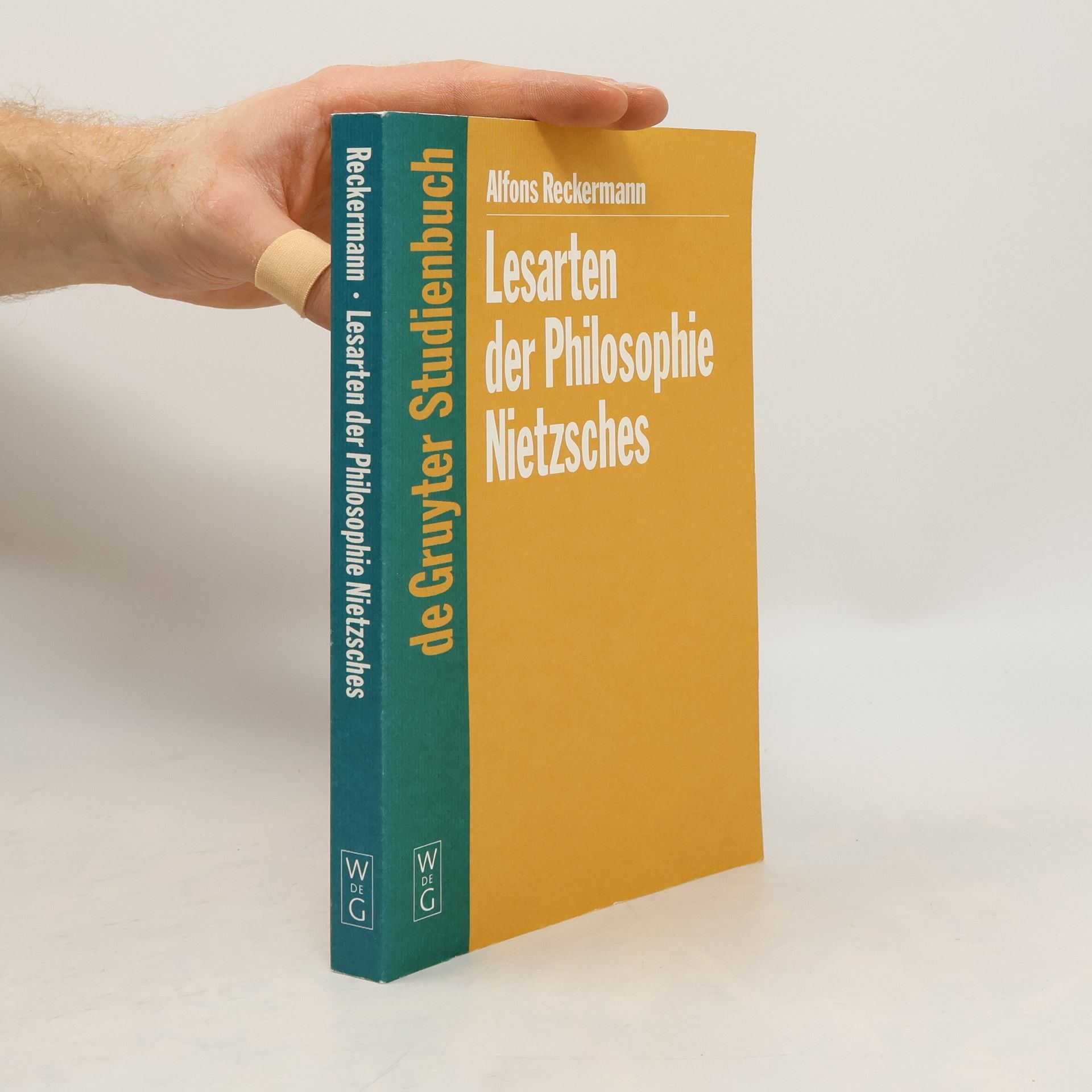De Gruyter Studienbuch: Lesarten der Philosophie Nietzsches
Ihre Rezeption und Diskussion in Frankreich, Italien und der angelsächsischen Welt. 1960-2000
- 336pages
- 12 heures de lecture
Reckermann gibt einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Formen philosophischer Nietzsche-Rezeption außerhalb des deutschsprachigen Raumes. Zu den behandelten Autoren gehören unter anderem Deleuze, Foucault, Derrida, Danto, de Man, Eagleton, Rorty, Colli, Montinari und Vattimo. Zudem arbeitet Reckermann systematisch die Voraussetzungen in den jeweiligen Ländern heraus, die es ermöglichten, Nietzsche für entscheidende Fragen der Gegenwartsphilosophie fruchtbar zu machen. Das Buch enthält eine ausführliche Bibliographie sowie Personen- und Sachregister. Unveränderter Nachdruck des Titels Lesarten der Philosophie Nietzsches der Reihe Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung.