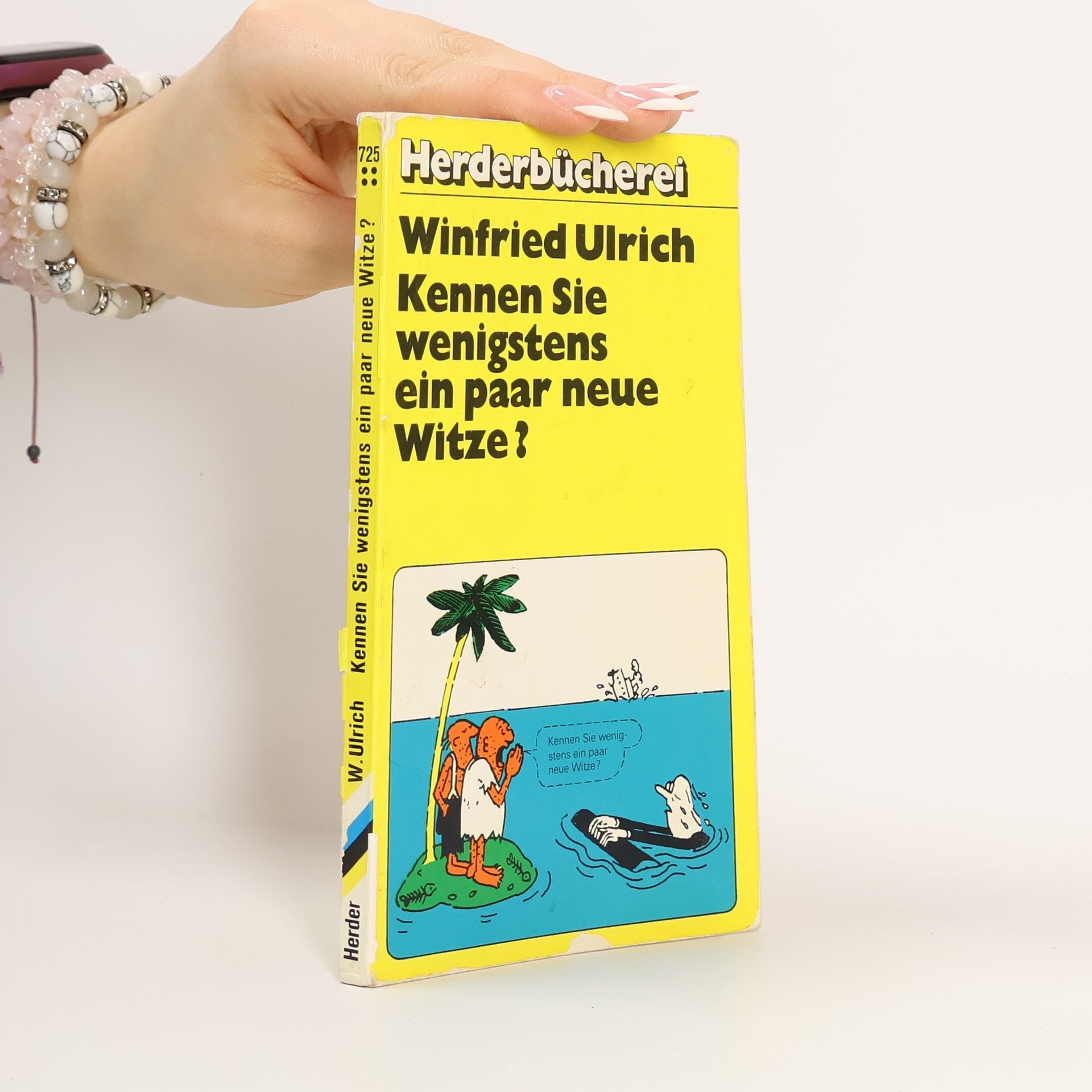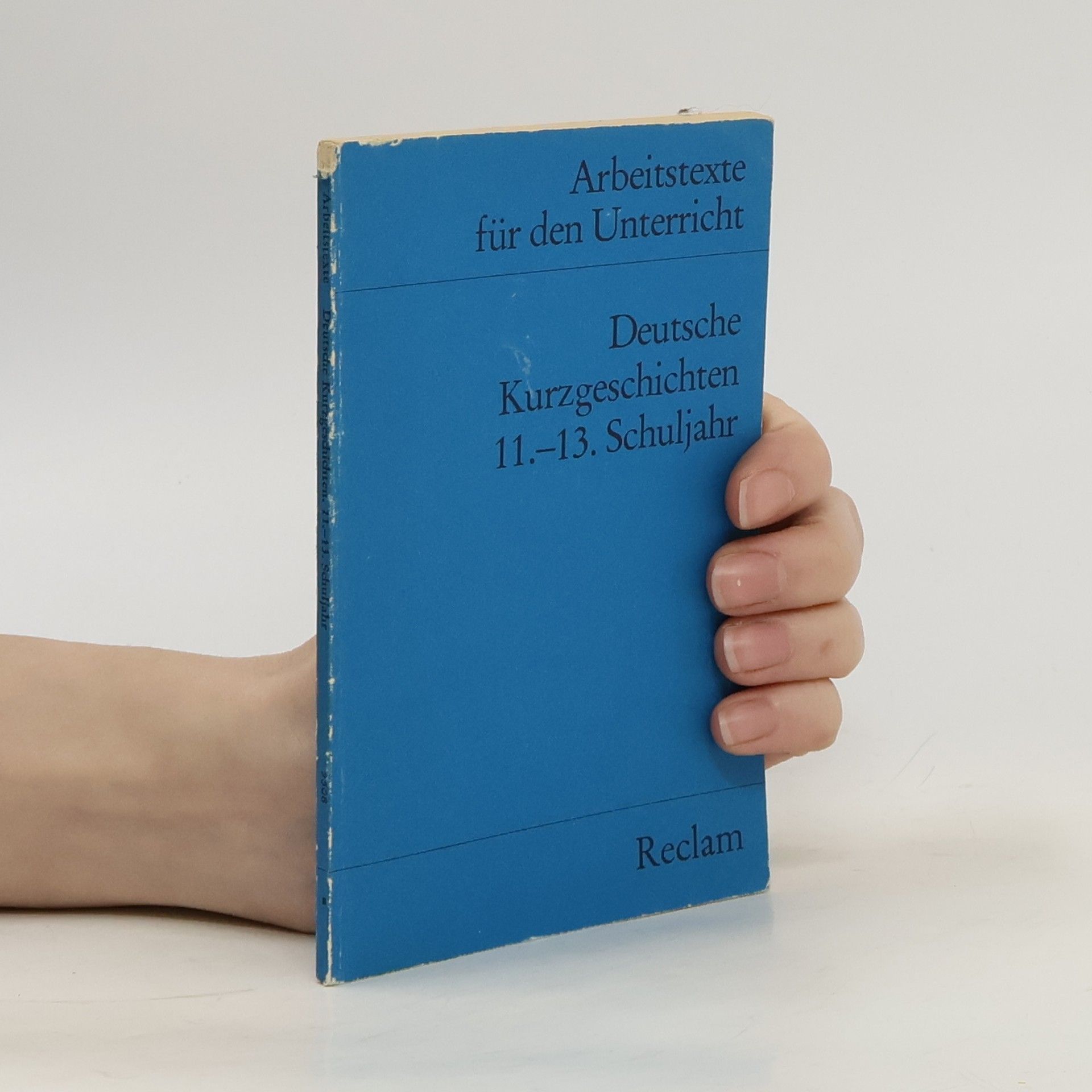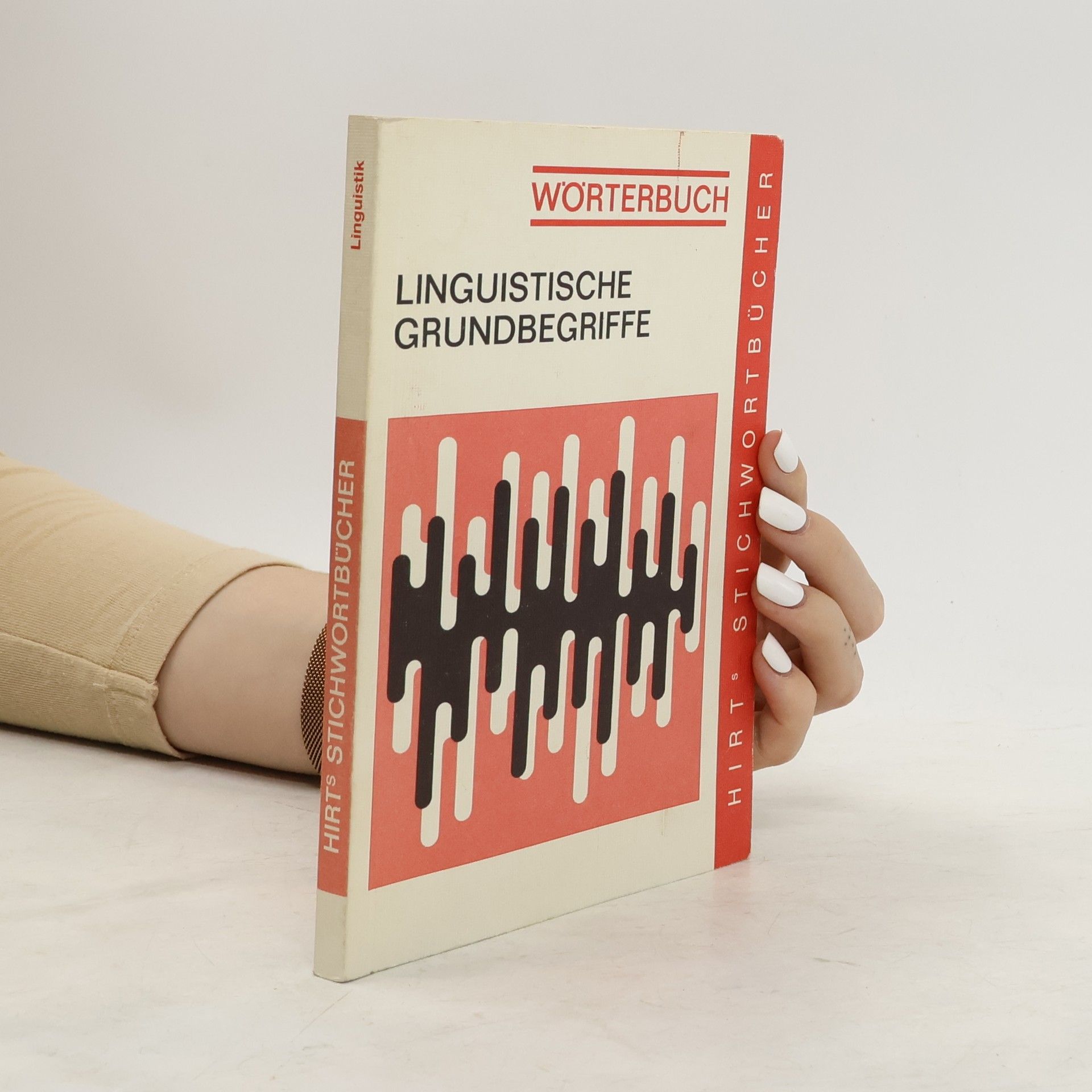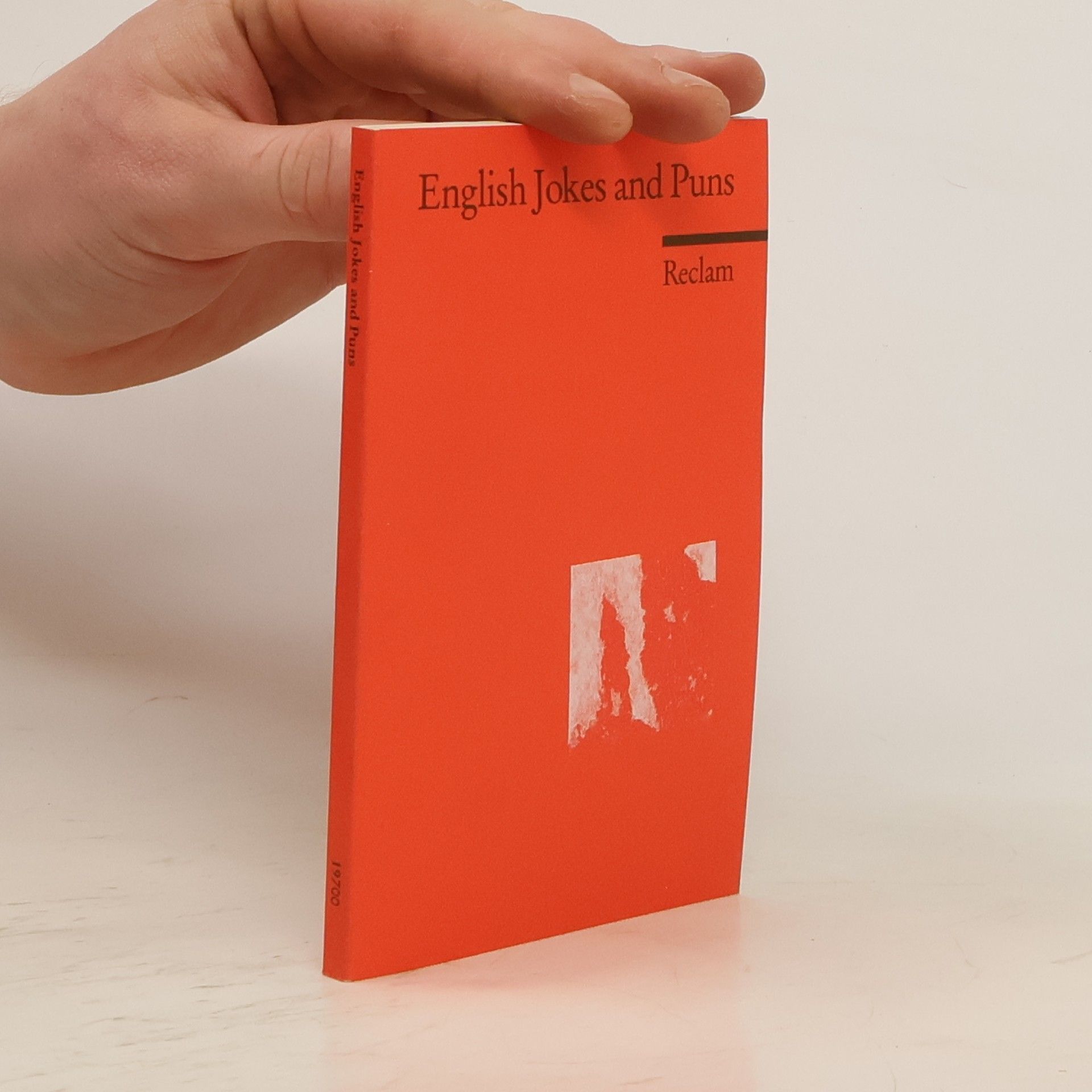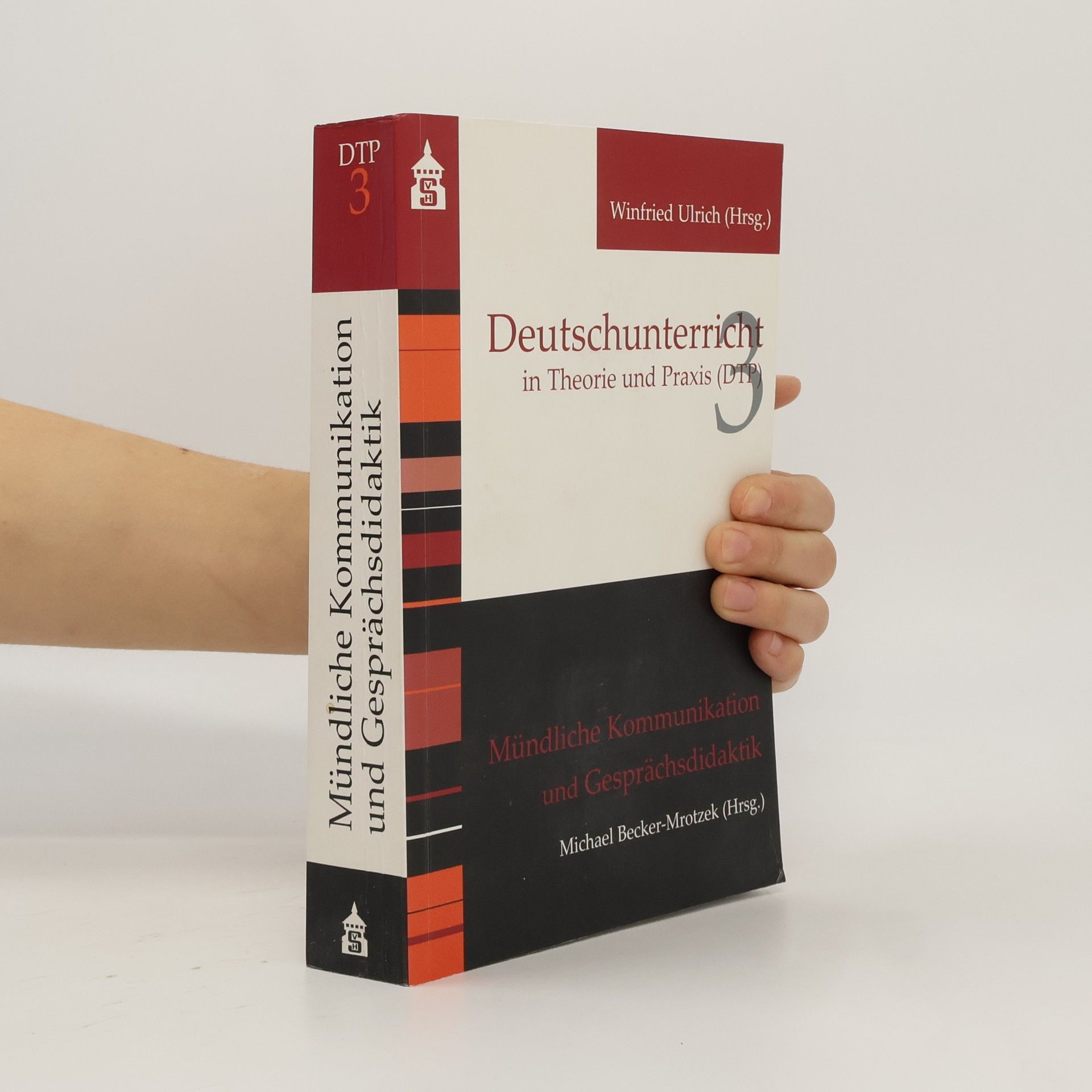Scheinbar oder anscheinend?
Ähnliche sprachliche Ausdrücke unterscheiden und richtig verwenden!
Anregungen und Arbeitsblätter für den Deutschunterricht und das Studium der deutschen Sprache thematisieren die oft vernachlässigte Ähnlichkeit sprachlicher Einheiten in Bezug auf ihre Erscheinungsformen und kommunikative Wirkung. Diese Ähnlichkeiten sind sowohl für die Sprachwissenschaft als auch für die Sprachdidaktik von Bedeutung, da sie Detailgenauigkeit in der Wahrnehmung von Sprache fördern und die Aufmerksamkeit auf formale sowie inhaltliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede lenken. Gemeinsame Merkmale können Gleichheit und Austauschbarkeit vortäuschen, weshalb es wichtig ist, sich auf die Unterschiede zu konzentrieren. Ähnliche Aussprache und Schreibweise einzelner Wörter dürfen nicht zur Verwirrung führen; Unterscheidungsschreibungen sind essenziell. Kontrastive Untersuchungen von „falschen Freunden“ helfen, Verwechslungen und Missverständnisse zu vermeiden. Die Wahl zwischen ähnlichen Ausdrücken ermöglicht eine Variation der Formulierungen und präzisiert Aussagen. Zitate können verfälscht werden, während kreative semantische „Umbiegungen“ besondere Wirkungen erzielen können. Zudem wird die Fähigkeit geschult, Volksetymologien und Verballhornungen zu erkennen und zu korrigieren. Ein „Ähnlichkeitstraining“ im Unterricht fördert das Bewusstsein für Unterschiede zwischen standardsprachlichen und umgangssprachlichen sowie fachsprachlichen Ausdrücken und deren angemessene Verwendung.