Fußnoten zur Literatur - 52: Mein Alphabet
- 99pages
- 4 heures de lecture
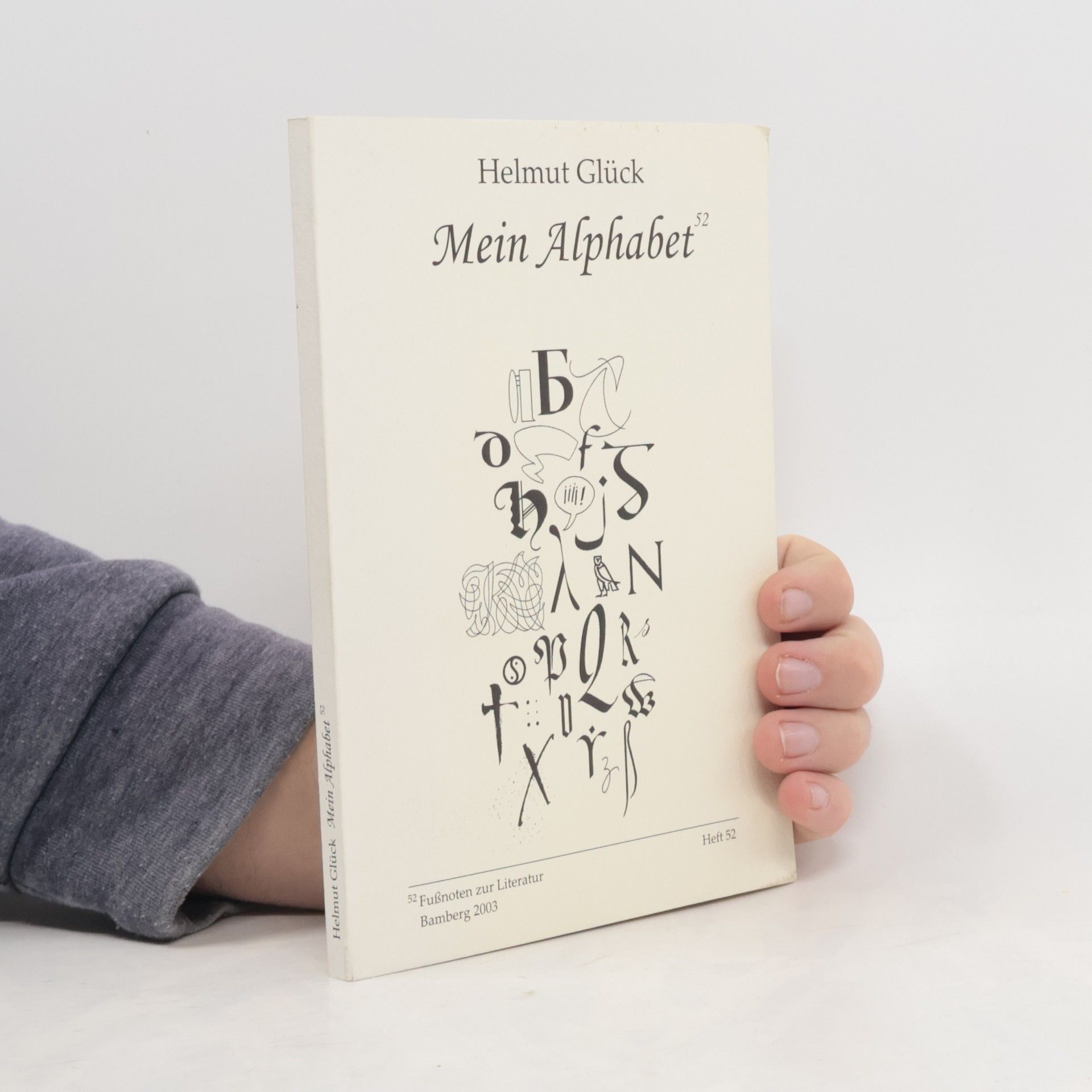
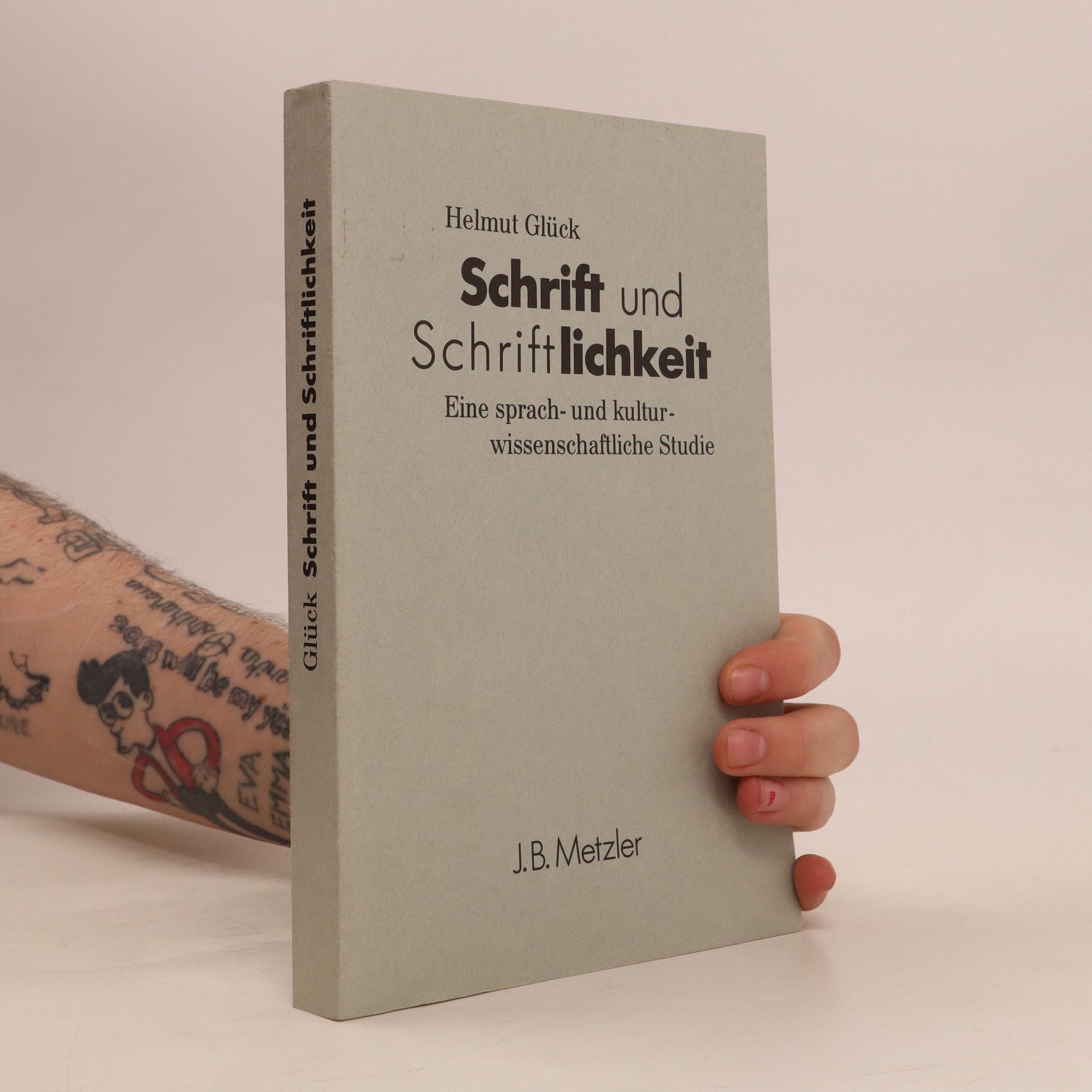
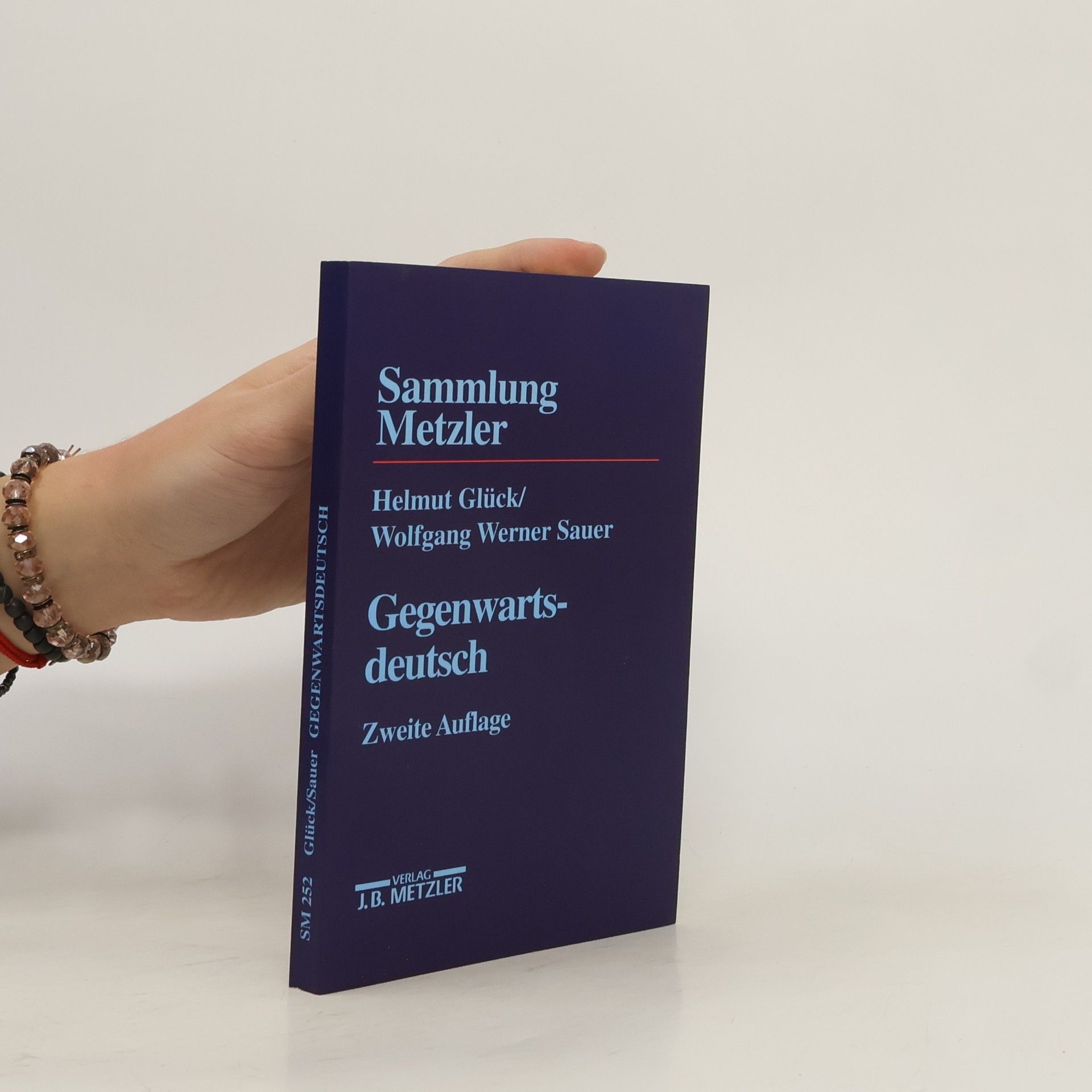

Die Neuauflage des 'Metzler Lexikon Sprache' ist um 400 Einträge erweitert und erschließt in rund 5400 Artikeln den gesamten Fachwortschatz der Sprachwissenschaft und ihrer verschiedenen Teildisziplinen.
Der Band gibt einen anschaulichen, mit zahlreichen Wort- und Bildbeispielen versehenen Überblick über aktuelle Entwicklungen der deutschen Sprache. Die 2. Auflage berücksichtigt die Sprachentwicklung nach dem Ende der DDR und die viel diskutierte Rechtschreibreform.
Eine sprach- und kulturwissenschaftliche Studie