Selten waren die Möglichkeiten, sein eigenes Leben zu gestalten wo und wie man will, so vielversprechend wie heute. Jedoch die lange Liste täuscht. Selbstverwirklichung ist mit Herkunft und Biografie verknüpft, alternative Haustypologien sind an die Ökonomie des Immobilienmarktes gebunden und alles endet schnell, wenn kein Geld da ist. Nicht wir bestimmen, wie wir leben wollen, sondern das verfügbare Kapital. Die Baugruppe findet kein leistbares Grundstück, der Kollektivraum entfällt wegen schlechter Ausnutzung und jedes Raumexperiment ist dem freien Spiel des Marktes ausgesetzt. Nichts ist so sehr mit Kapital verbunden wie das Bauen von Stadt. Da fällt es schwer, an wählbare Identitäten und dafür geeignete Architekturen zu glauben. Die Stadt muss wachsen, Profit sticht Gemeinwohl und Stillstand im Bauboom wäre ein Rückschlag im Wettbewerb.Das Resultat sind Wohnhäuser mit Regelgeschossen, generische Shoppingmalls und ein schwindender öffentlicher Raum. Aber wollen wir all das so bauen? Welchen Werten folgt Architektur?Zehn Autor*innen schreiben Handlungsanweisungen für gedachte und gebaute Lebensmodelle, Alternativen zur Investorenstadt, antiglobale Architekturen, neue Produktionsformen, Individualität, Kollektivität und ein neues Verhältnis zur Natur. Letztlich dreht sich alles darum: Wie macht man es jetzt gut, so dass es dann gut läuft, beim Wohnen, Arbeiten, Lieben und Leben?
Sabine Pollak Livres

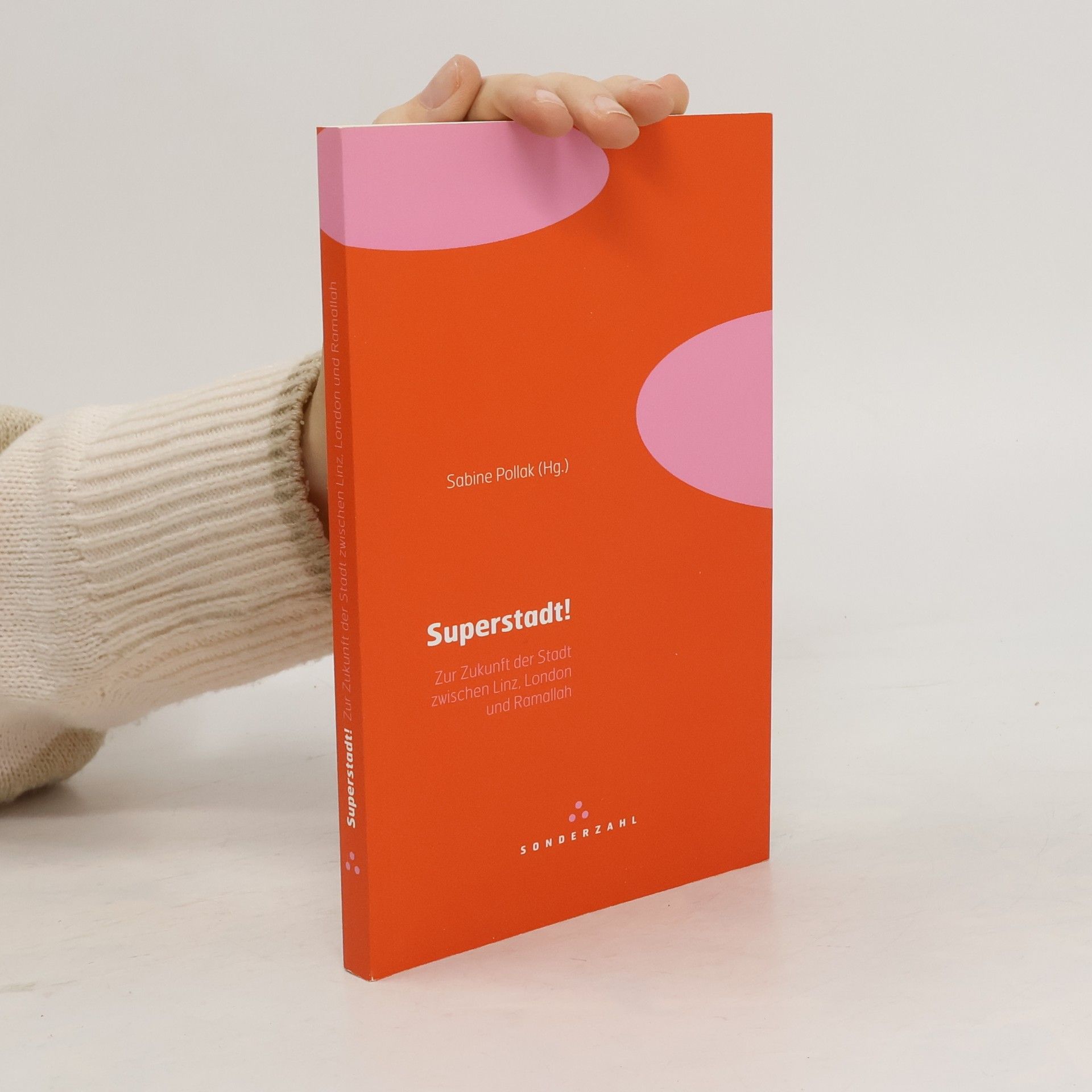
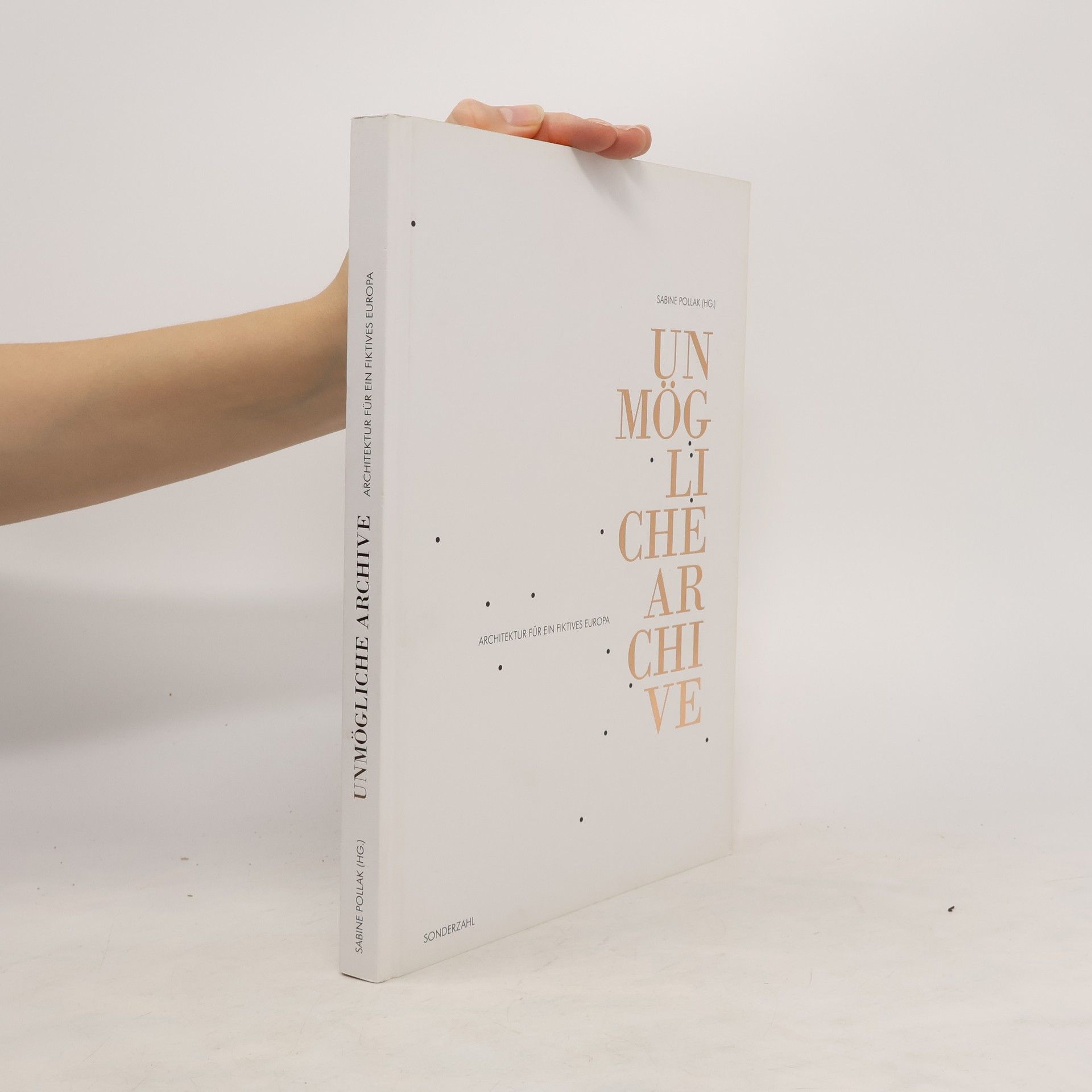

Unmögliche Archive
- 191pages
- 7 heures de lecture
Ausgangspunkt dieser Architekturreise ist die Frage nach den Anforderungen und Voraussetzungen eines Archivs. Der nächste Schritt denkt über die möglichen Bezüge zwischen Archiv und Architektur – zwischen Archivkörper und Baukörper – nach. Unmögliche Archive stellt dabei den Ziegelbau in den Mittelpunkt, die Struktur, Spezifika, Systematik des Ziegels und verbindet sie mit einer ›Logik des Archivierens‹. Die Reise geht schließlich über den Archivbau hinaus in gedankliche Sphären: Was, wenn man die zu bewahrenden Dinge gar nicht sehen würde? Wenn wir unsere Gefühle und Stimmungen, Wünsche und Sehnsüchte archivieren würden? Mit solchen Fragen im Hintergrund machen sich fünfzehn Entwürfe daran, ›realutopische‹ Archivbauten für ein fiktives Europa zu gestalten, ein Europa, wie es einmal war oder hätte sein können oder wie es vielleicht einmal sein wird. Fünf ExpertInnen begleiteten das Projekt und leiten das Buch ein mit kultur- und medienwissenschaftlichen Texten zu den Themen Archiv und Ziegelbau. TEXTE von Johannes Kapeller, Lars Moritz, Laurids Ortner, Sabine Pollak und Sarah Sander PROJEKTE von Stefanie Bauer, Michael Brunmayr, Karina Eder, Barbara Friesenecker, Felix Ganzer, Stefan Gruber, Andrea Hilmbauer, Josef Kienesberger, Wolfgang Lang, Hanna Pittschieler, Nicole Rodlsberger, Sophie Schrattenecker, Veronika Schwarzecker, Anika Welebny und Martin Zierer
Über den gesamten Globus verstreut entwickeln sich neue Formen von Urbanität, deren Gemeinsamkeiten weder in der Ähnlichkeit ihrer lokalen Ausprägungen liegen, noch als Ausdruck einer „allgegenwärtigen“ und „unvermeidlichen“ globalen Entwicklung zu sehen sind. Sie verbindet stattdessen ein Milieu von situativen Experimenten, in denen urbane Normen immer wieder neu erfunden werden.
Leere Räume
Weiblichkeit und Wohnen in der Moderne