The Plotless Room - I Lie to History
- 283pages
- 10 heures de lecture
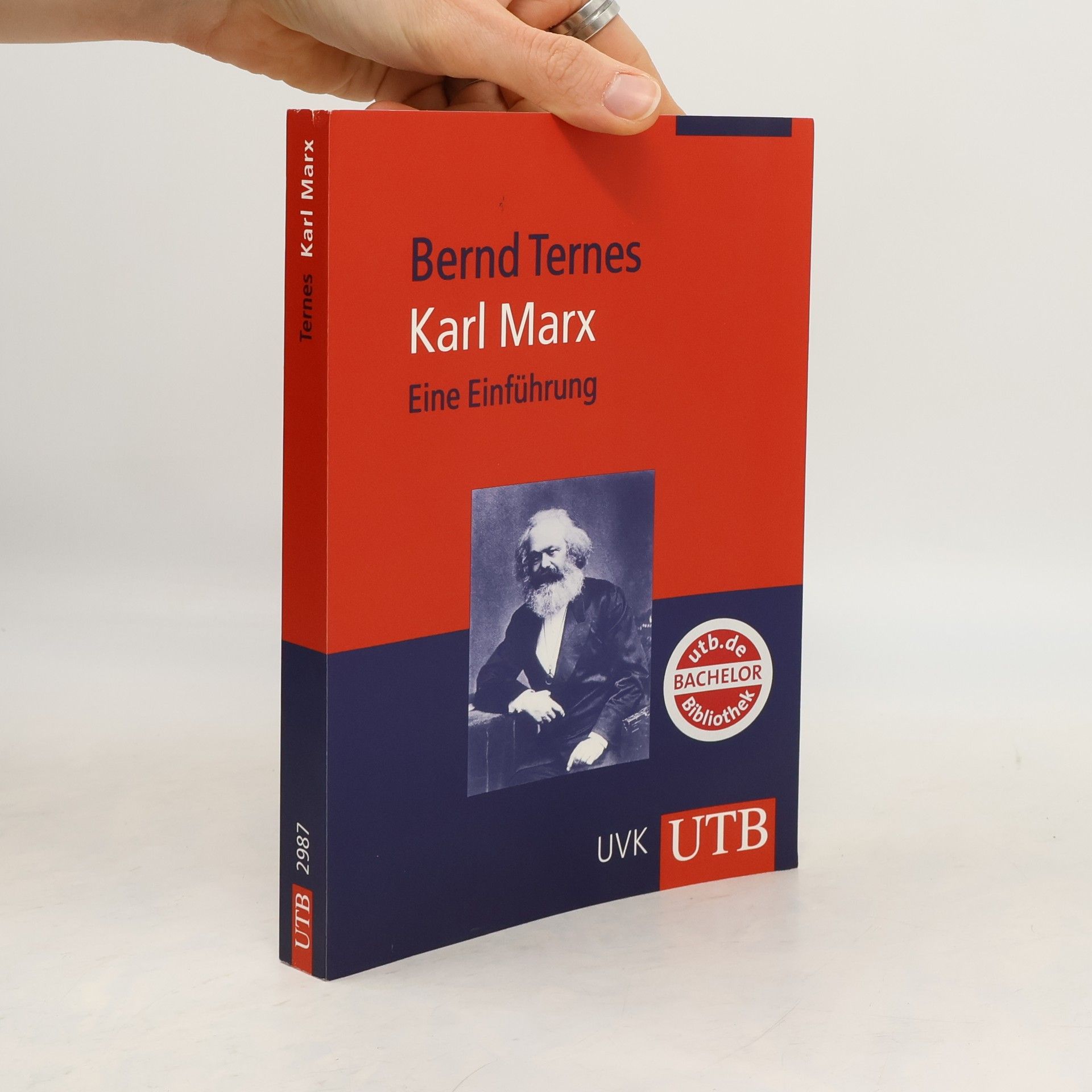

In dieser Einführung wird Karl Marx als philosophischer, polit-ökonomischer, klassenkampf- und gesellschaftstheoretischer Denker vorgestellt. Der Autor erläutert Marx' zentrale Begriffe und Überlegungen und bettet sie in die Diskurse seiner Zeit ein. So ermöglicht er ein nachhaltiges Verstehen des Marx'schen Gedankengebäudes. Zugleich erschließt er dessen kulturwissenschaftliches Potenzial und seine Bedeutung für die heutige Soziologie. Ein biografisches Kapitel und ein Glossar runden den Band ab. Bernd Ternes ist Privatdozent am Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin und Mitbegründer der menschen formen e.V. Berlin.