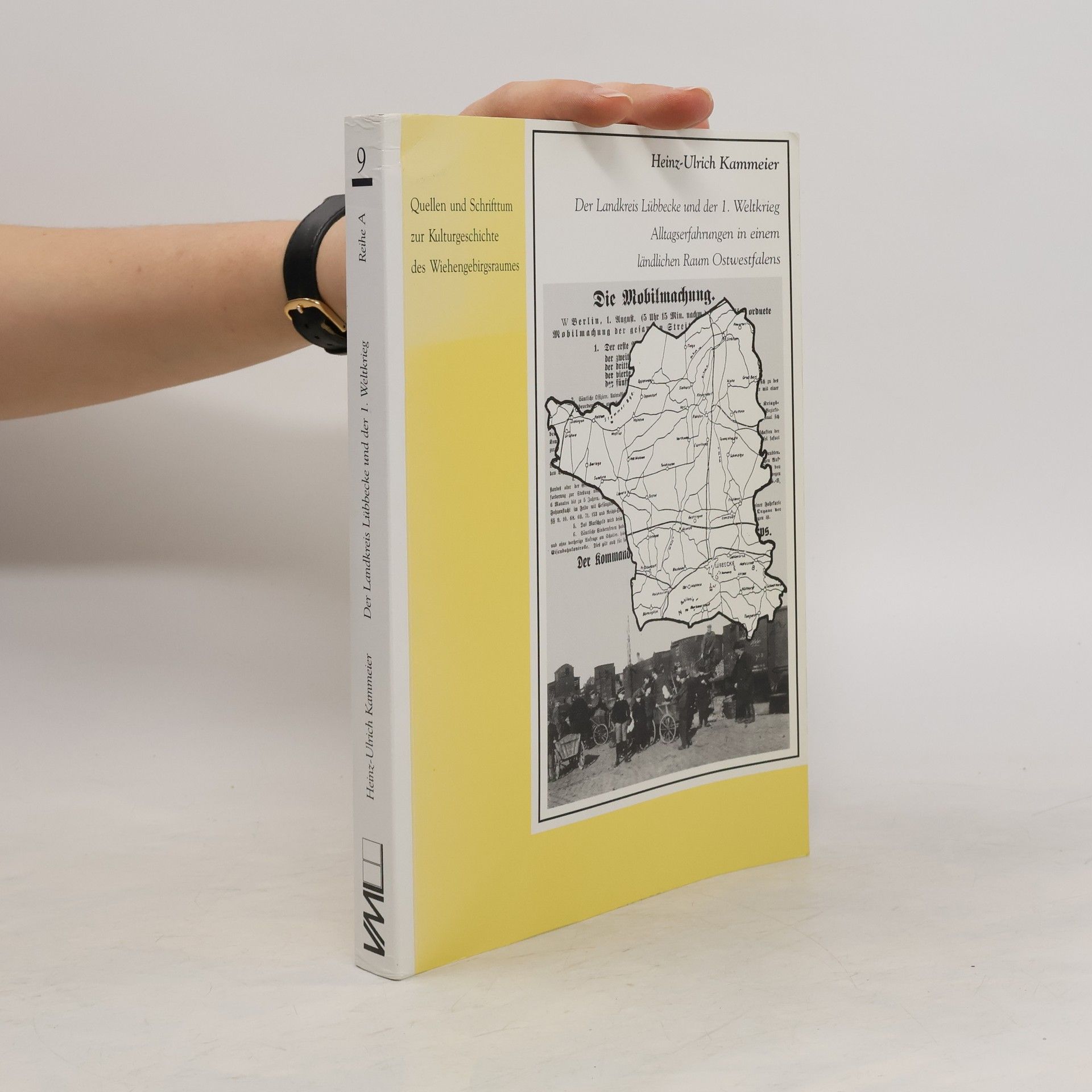Am 11.11.1998 jährte sich zum achtzigsten Mal das Ende des Ersten Weltkrieges, was Anlass für diesen Band gab, der auf Vorträgen des Autors aus dem Jahr 1997 basiert. Obwohl der frühere Kreis Lübbecke kein Kampfgebiet war, betraf das Kriegsgeschehen fast jeden Anwohner. Anhand vielfältiger Quellen wird der Verlauf und die Wirkung des Krieges exemplarisch für andere ländliche Regionen des Reiches untersucht. Im Mittelpunkt stehen nicht die allgemeine politische oder militärische Geschichte, sondern Aspekte wie Verwaltung, Mobilmachung, Versorgung, Frontalltag, Landwirtschaft, Gefangene, Schulen, Kirche und die Stimmung der Bevölkerung zwischen 1914 und 1918. Die 2.300 Gefallenen, Vermissten und Kriegsopfer aus Lübbecke werden namentlich nach Gemeinden aufgeführt. Das Buch enthält zahlreiche eindringliche Fotografien und Dokumentenabbildungen sowie persönliche Kriegsberichte von Soldaten, die durch Tagebuch- und Briefauszüge veranschaulicht werden. Es schließt mit einem umfangreichen Literaturverzeichnis und einem Quellenanhang, der Archive, Privatpersonen, Firmen, Zeitungen und Zeitschriften umfasst.
Heinz Ulrich Kammeier Livres