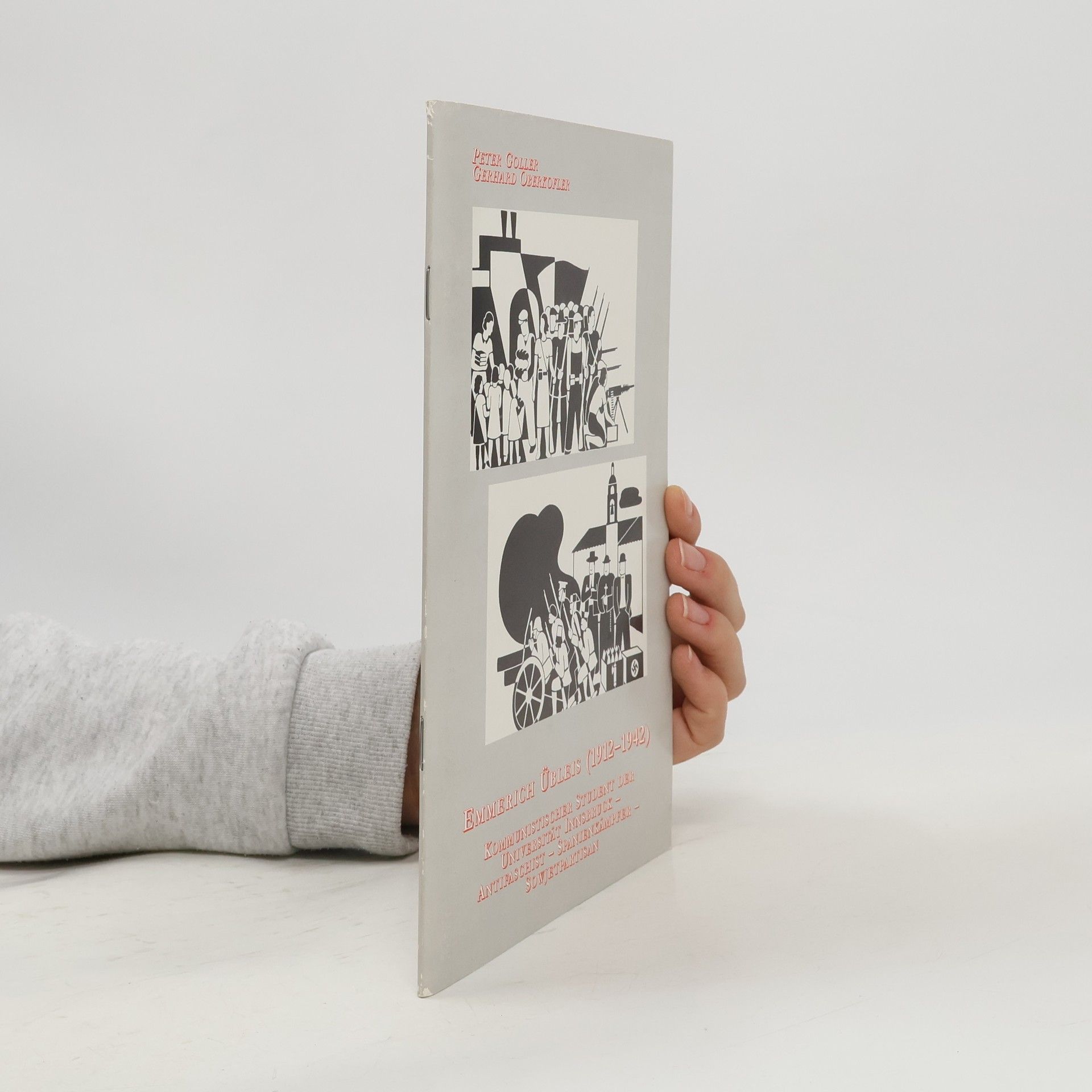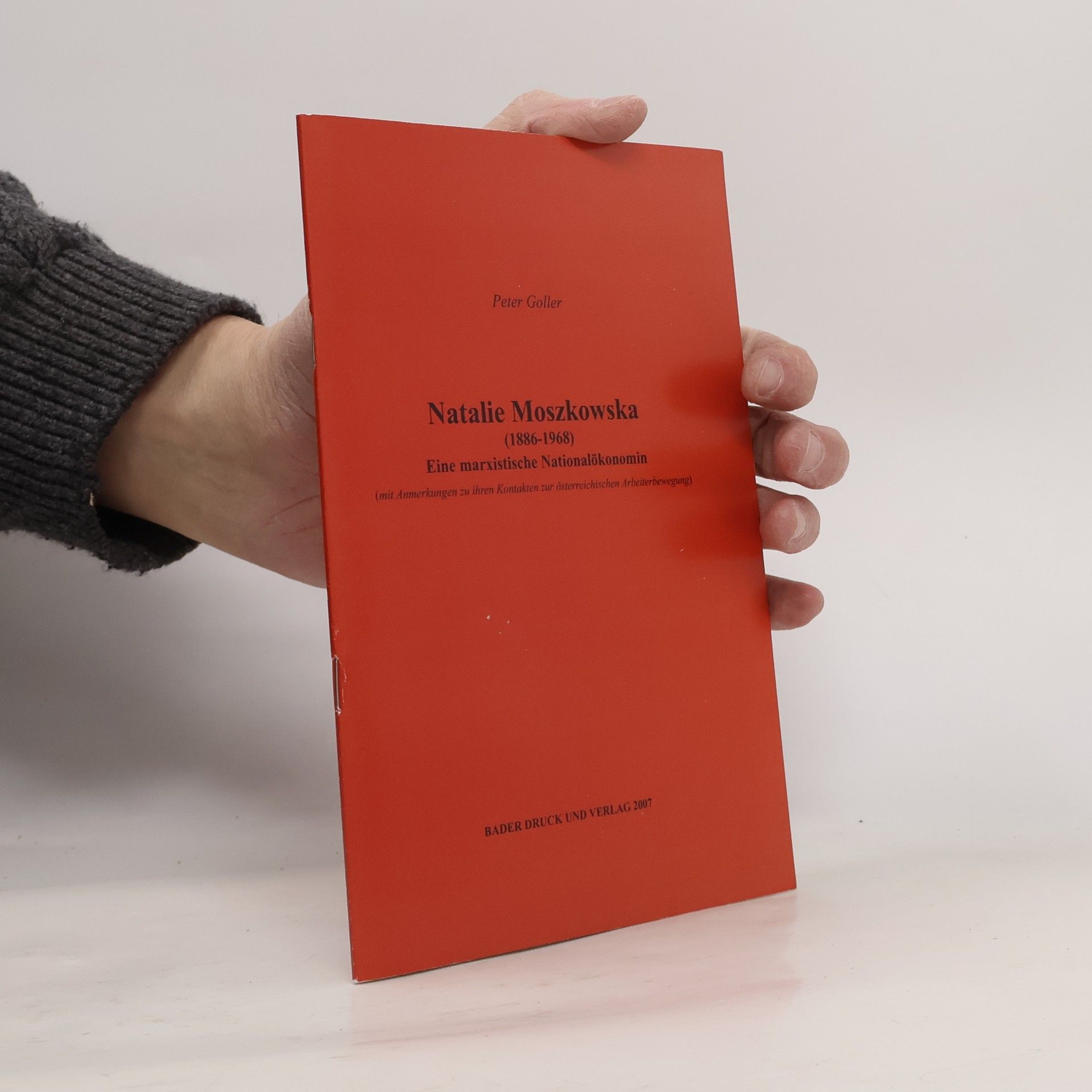Der Band 9 der von der Alfred Klahr Gesellschaft herausgegebenen Reihe „Quellen & Studien“ erinnert mit Otto Bauer (1881–1938) und Max Adler (1873–1937) an zwei vor 70 Jahren verstorbene Exponenten des „Austromarxismus“, an deren Rolle im reformistischen Hauptstrom der österreichischen Sozialdemokratie, an deren „dritte Wege“ („integraler Sozialismus“ bzw. „Linkssozialismus“) und an deren widersprüchliche Funktion in marxistischen Theoriedebatten nach der Befreiung vom Faschismus.
Peter Goller Livres






„… wegen der geringsten Vergehen gegen das Koalitionsrecht!“
Streik- und Arbeiterkoalitionsrecht in Österreich 1867–1914. Aus Texten von Leo Verkauf und Isidor Ingwer
1870 erlangte die österreichische Arbeiterklasse das Koalitionsrecht. Sozialdemokratische Arbeitsrechtler wie Isidor Ingwer und Leo Verkauf dokumentierten vor 1914, wie das Streikrecht durch den habsburgischen Behördenapparat stark eingeschränkt wurde, oft unter militärischer Gewalt. Beispiele sind die tödlichen Arbeitskämpfe wie der Streik der böhmisch-mährischen Bergarbeiter 1894, der Wiener Ziegelarbeiterstreik 1895, der Bergarbeiterstreik 1900, der Generalstreik in Triest 1902 und der Maurer- und Zimmererausstand in Lemberg 1902. Viele Arbeiter wurden wegen kleiner Verstöße gegen das Koalitionsgesetz bestraft, und die Erpressungsnormen des Strafrechts wurden gegen Streikende eingesetzt. Arbeitervereine wurden verboten, und Streikversammlungen aufgelöst. Mit dem „Prügelpatent“ von 1854 wurde gegen Streikposten vorgegangen, und zahlreiche Arbeiter wurden nach der „Kontraktbruchregelung“ der Gewerbeordnung sanktioniert. Die „Vagabundengesetzgebung“ führte zur Abschiebung und „Abschaffung“ von Streikenden. Isidor Ingwer, der 1893 wegen des Ausrufs „Es lebe die rothe revolutionäre Socialdemokratie!“ als „äußerst gefährlicher Agitator“ verurteilt wurde, starb 1942 kurz nach seiner Deportation im KZ Theresienstadt.
Die Neugründung der Medizinischen Fakultät Innsbruck 1869
"... fürchteten, man könnte sie da in den Tiroler Bergen vergessen"
An der 1869 neu gegründeten Medizinischen Fakultät Innsbruck lehrten in den folgenden Jahrzehnten trotz schwieriger Forschungsbedingungen international renommierte Gelehrte. Neben den drei Nobelpreisträgern für Chemie Fritz Pregl, Adolf Windaus und Hans Fischer, die in Innsbruck zwischen 1910 und 1918 die Lehrkanzel der Medizinischen Chemie innehatten, wirkten hier der ?Wiener Medizinischen Schule? angehörende Professoren wie Ludwig Mauthner (Augenheilkunde), Eduard Albert (Chirurgie) oder Viktor Ebner (Histologie). Aus Breslau wurde 1889 der ?Entwicklungsanatom? Wilhelm Roux berufen, aus Leipzig 1916 der Physiologe Ernst Theodor Brücke. An der Seite des 1938 ?aus rassischen Gründen? aus der Professur vertriebenen Brücke wirkte der 1913 habilitierte Hormonforscher Ludwig Haberlandt. In einem Anhang werden die Lage der MedizinƯfakultät nach der Befreiung von 1945, der Weg der ?Entnazifizierung? und die Neuordnung des Personalstandes beschrieben.
"Während der Schlacht ist es schwer, Kriegsgeschichte zu schreiben, ..."
Geschichtsschreibung der österreichischen Arbeiterbewegung vor 1934
- 112pages
- 4 heures de lecture
Viktor Adler hat 1908 bedauert, dass die „notwendigsten Vorarbeiten für ein eindringendes Verständnis der Geschichte der proletarischen Bewegung fehlen“: „Während der Schlacht ist es schwer, Kriegsgeschichte zu schreiben, (…).“ Die bürgerliche Geschichtswissenschaft an den österreichischen Universitäten ignorierte das Thema. Vielmehr entstanden die ersten historischen Rückblicke am Ende des 19. Jahrhunderts zur eigenen Selbstverständigung, zum „Behelf der Agitation“ aus der sozialdemokratischen und auch aus der „anderen“ radikalen Arbeiterbewegung selbst. Wichtige erste Beiträge zur Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung lieferten etwa Carl Grünberg, Ludwig Brügel, Julius Deutsch, Emil Strauß oder August Krcal.
Im vorliegenden Band wird die an den Universitäten knapp vor 1900 einsetzende Auseinandersetzung mit Marx und Engels beschrieben, in Deutschland waren dies die „Kathedersozialisten“ (Schmoller, Sombart u. a.), in Österreich vor allem die liberale Wiener „Grenznutzenlehre“, vor allem Böhm-Bawerk und dann Ludwig Mises. Im Gegenzug wurde in den sozialistischen, marxistischen Theorieorganen (u. a. „Neue Zeit“, Berlin, „Der Kampf“ Wien, „Unter dem Banner des Marxismus“, etc.) die bürgerliche Marx-Engels-Adaption scharfer Kritik unterzogen, so von Franz Mehring, Rosa Luxemburg oder von Georg Lukács. Dieser sozialistischen Kritik ist der zweite Teil des vorliegenden Bandes gewidmet.
Verschärfte Arbeitskämpfe in Österreich, im November 2003 erfolgte Drohungen, streikende Eisenbahner zu entlassen, aggressiver werdende Eingriffe in Rechte der Arbeiterklasse führen zur Frage, wie sich die Ende des 19. Jahrhunderts an den österreichischen Hochschulen entstehende Arbeitsrechtswissenschaft zum Koalitions- und Streikrecht gestellt hat. Wie arrangierte sich die bürgerlich-universitäre Rechtswissenschaft mit der „Werkgemeinschaftsideologie“ des Austrofaschismus, der „nationalen Arbeitsordnung“ des NS-Faschismus? In vorliegender Abhandlung von Univ. Doz. Dr. Peter Goller (Universität Innsbruck) wird die Geschichte der österreichischen Arbeitsrechtswissenschaft seit Ende des 19. Jahrhunderts aus der Sicht zweier Juristen der Arbeiterklasse – dem 1942 im KZ Theresienstadt ermordeten Arbeiteranwalt Isidor Ingwer (1866–1942) und dem von der Gestapo als Mitglied der kommunistischen Widerstandsgruppe „Soldatenrat“ verhafteten, späteren Wiener Arbeiterkammerjuristen Eduard Rabofsky (1911–1994) – beschrieben.