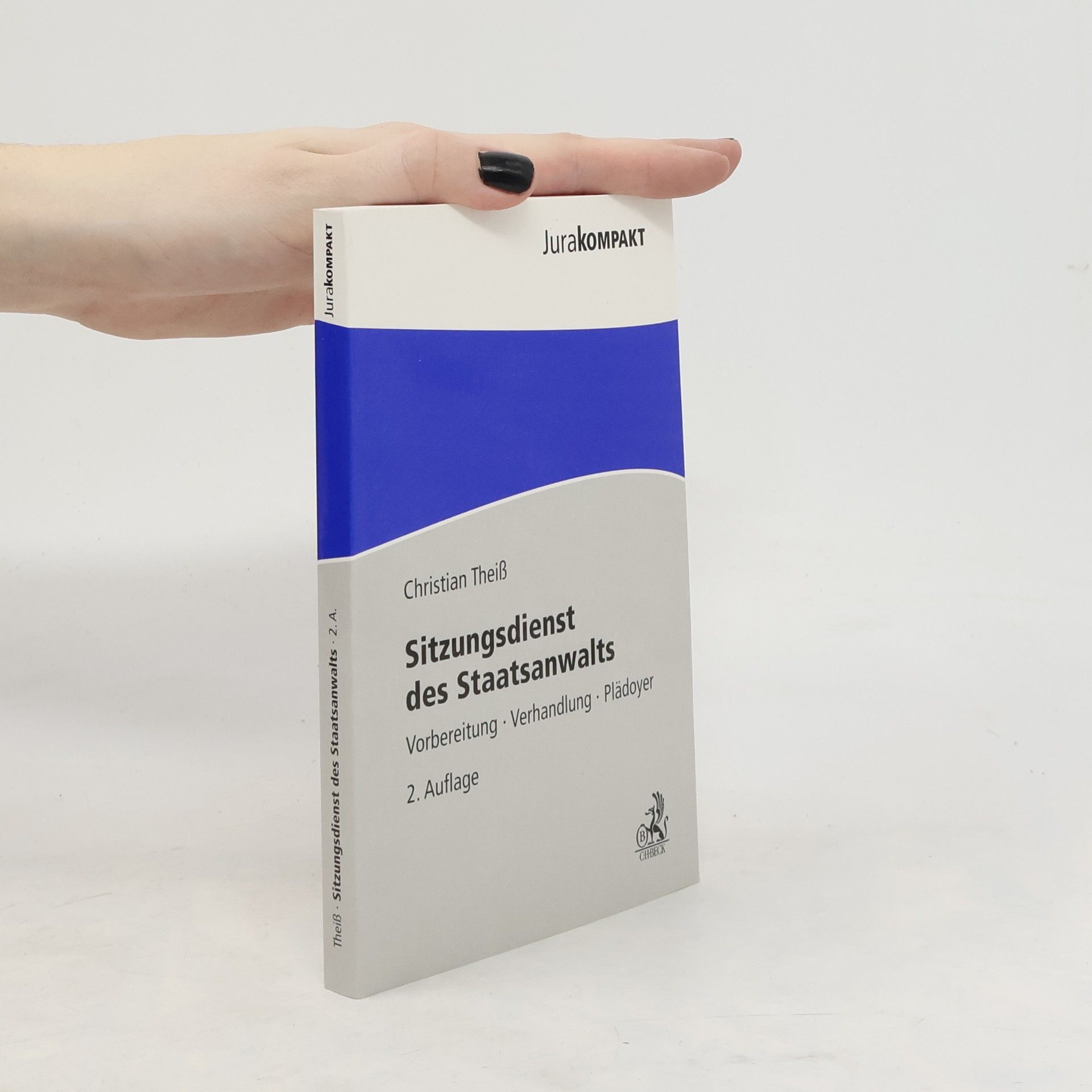Bewegte Freizeiten als Referenzen institutioneller Bildung
Tagungsband der DGfE-Jahrestagung Kommission Sportpädagogik vom 28.–30. November 2019 in Mainz
Von digitalisierten jugendlichen Freizeiten, uber den Sportunterricht als Raum fur Integrationsprozesse, bis hin zu Sporterlebniswelten oder kirchlicher Sportarbeit. In diesem Tagungsband werden verschiedene Diskurse aufgegriffen, die freizeitliches Sportengagement mit institutionellen Angeboten in Verbindung bringen. Ausserdem wird diskutiert, wie sich schulisch erworbene Kompetenzen im Leben ausserhalb von Bildungseinrichtungen nutzen lassen. Wenn kindliche und jugendliche Freizeiten als Referenzen von Bildung verstanden werden, stellen sich in erzieherischen Institutionen sowohl Fragen der adaquaten Vorbereitung als auch der freizeitgerechten Thematisierung. Aufgrund der Vielfalt der Ansatze ist diese Beitragssammlung u.a. fur Sportpadagogen und -wissenschaftler, Freizeitforscher und Beschaftigte der Sozialen Arbeit besonders interessant.