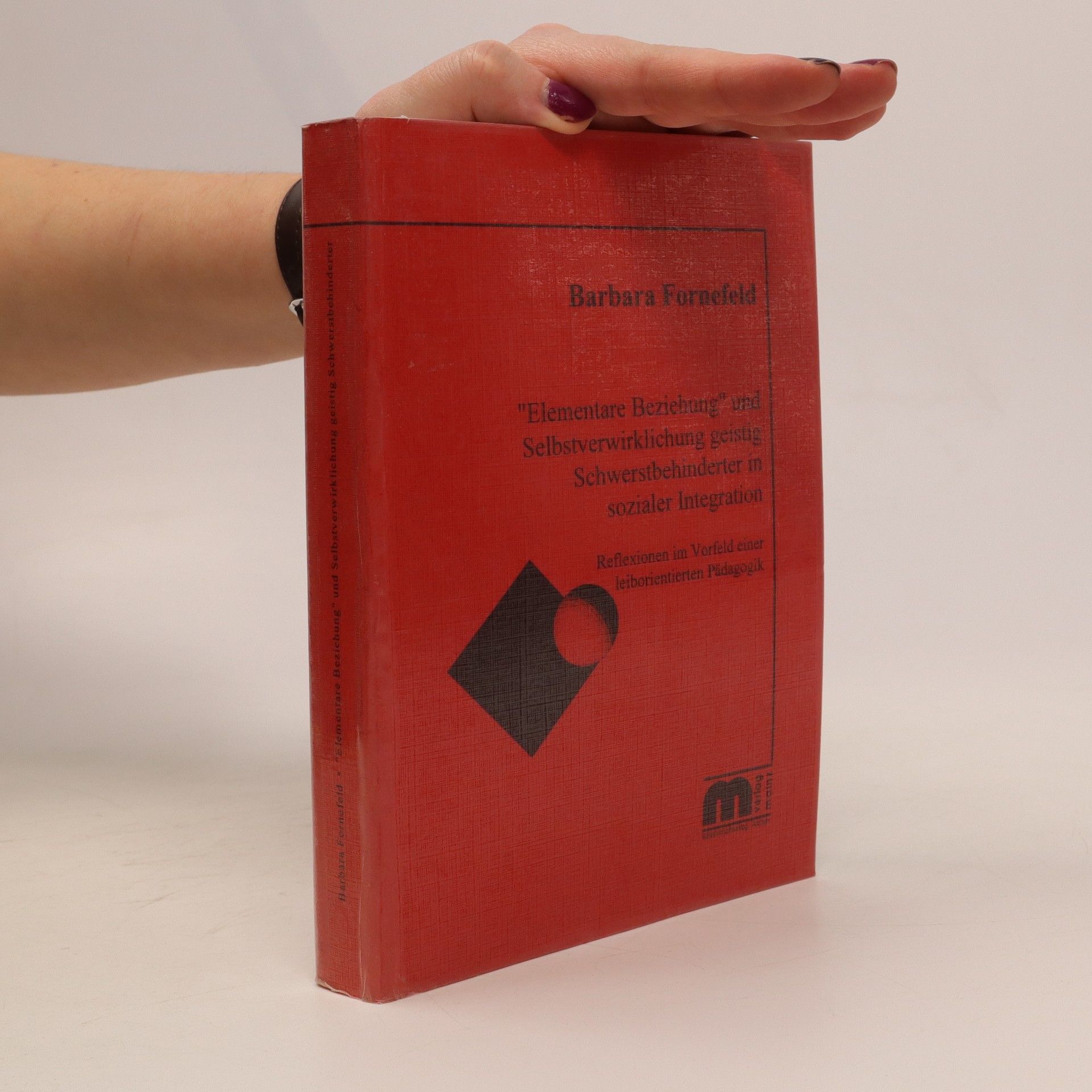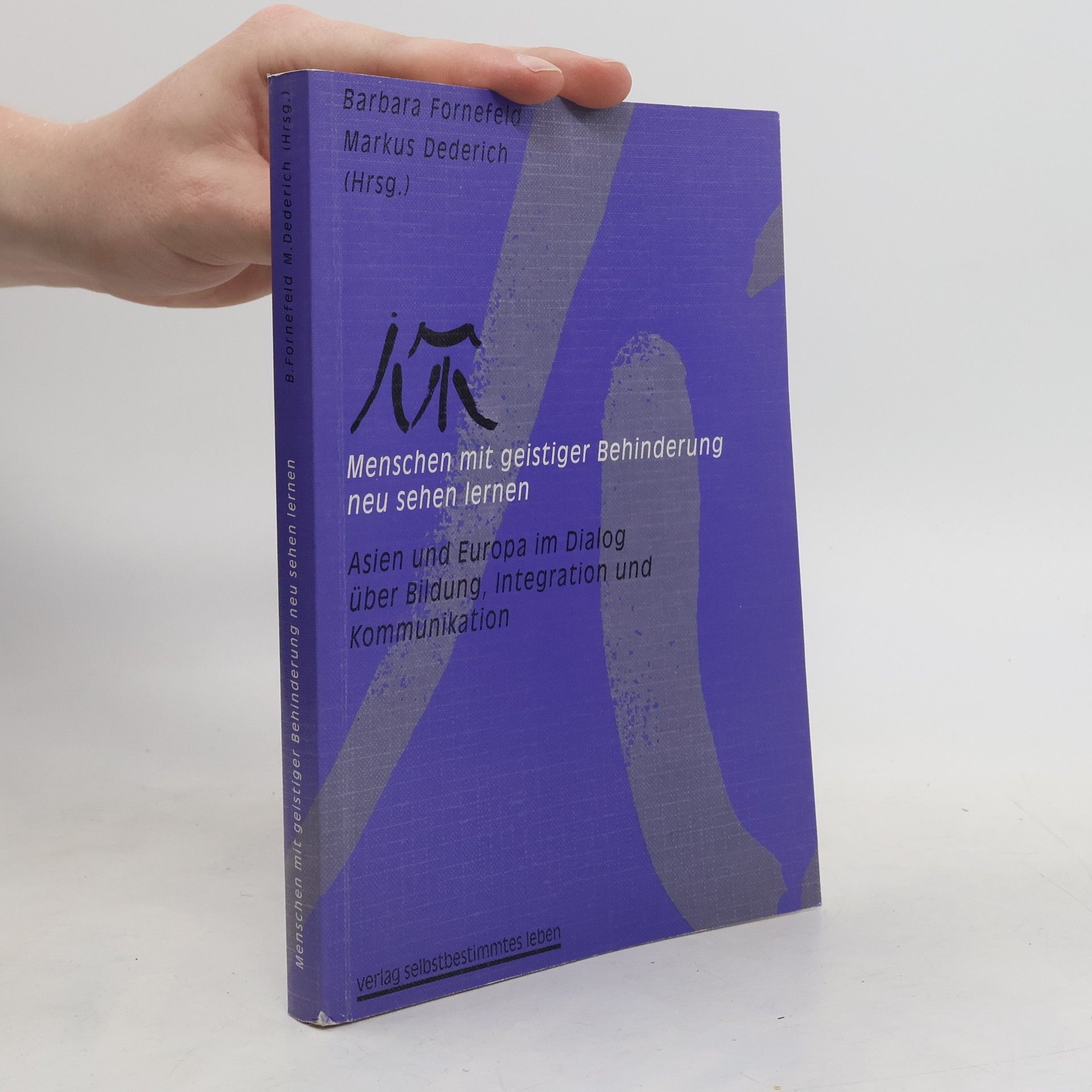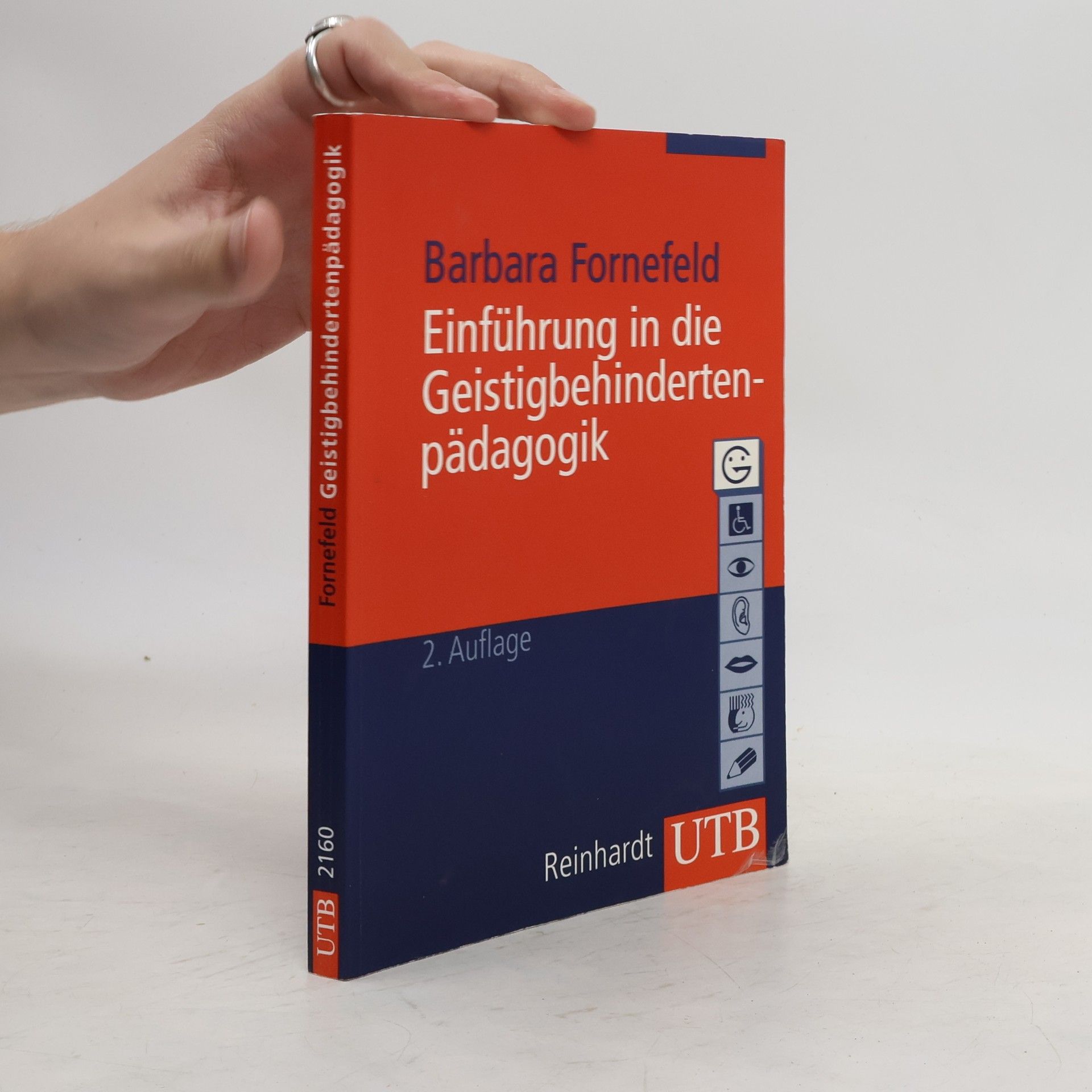Einführung in die Geistigbehindertenpädagogik
- 197pages
- 7 heures de lecture
Das Buch gibt einen Einblick in die zentralen Themenstellungen und die vielfältigen Aufgabenfelder der Geistigbehindertenpädagogik, von der Frühförderung bis zur Begleitung im Alter. Das Buch führt anschaulich in das komlexe Gebiet der Geistigbehindertenpädagogik ein. Es gibt einen Einblick in die zentralen Themenstellungen und die vielfältigen Aufgabenfelder der Geistigbehindertenpädagogik, die von der Frühförderung über schulische und nachschulische Erziehung, Arbeit, Wohnen, Freizeit bis hin zur Begleitung im Alter reichen. Der didaktische Aufbau mit Marginalspalte und Glossar erleichtern den Studierenden das Lernen. Übungsfragen dienen der unmittelbaren Lernzielkontrolle und regen zur weiterführenden Diskussion an. Nützliche Adressen im Anhang weisen auf zusätzliche Informationsquellen hin.