In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts rund 200 Jahre vor Martin Luther hat ein Anonymus große Teile der Bibel ins Deutsche übersetzt und teilweise mit ausführlichen Erläuterungen versehen, die sich aus der lateinischen Kommentartradition sowie apokryphen und erbaulichen Texten speisen. Durch das hohe sprachliche Niveau und die programmatische Verteidigung des Anspruchs, als Laie für Laien die Heilige Schrift mit Kommentaren in der Volkssprache zugänglich zu machen, kommt ihm eine besondere Stellung in der Geschichte der Bibelübersetzung vor Luther zu. Mit dem Alttestamentlichen Werk` wird hier ein erster wesentlicher Teil seiner umfangreichen Bibel-Werke auf der Grundlage der kompletten handschriftlichen Überlieferung ediert. Enthalten sind die sparsam glossierten Bücher Daniel, Genesis, Exodus, Tobias und Hiob sowie, ausführlicher kommentiert, Proverbia und Ecclesiastes. Integraler Bestandteil sind die beiden deutschen Vorreden, mit denen der Bibelübersetzer sein Projekt rechtfertigt und verteidigt. Die Einleitung erschließt Werke und Profil des Anonymus, seine Arbeits- und Übersetzungsweise sowie die benutzten Handschriften, zudem erläutert sie das textkritische Verfahren.
Jens Haustein Livres
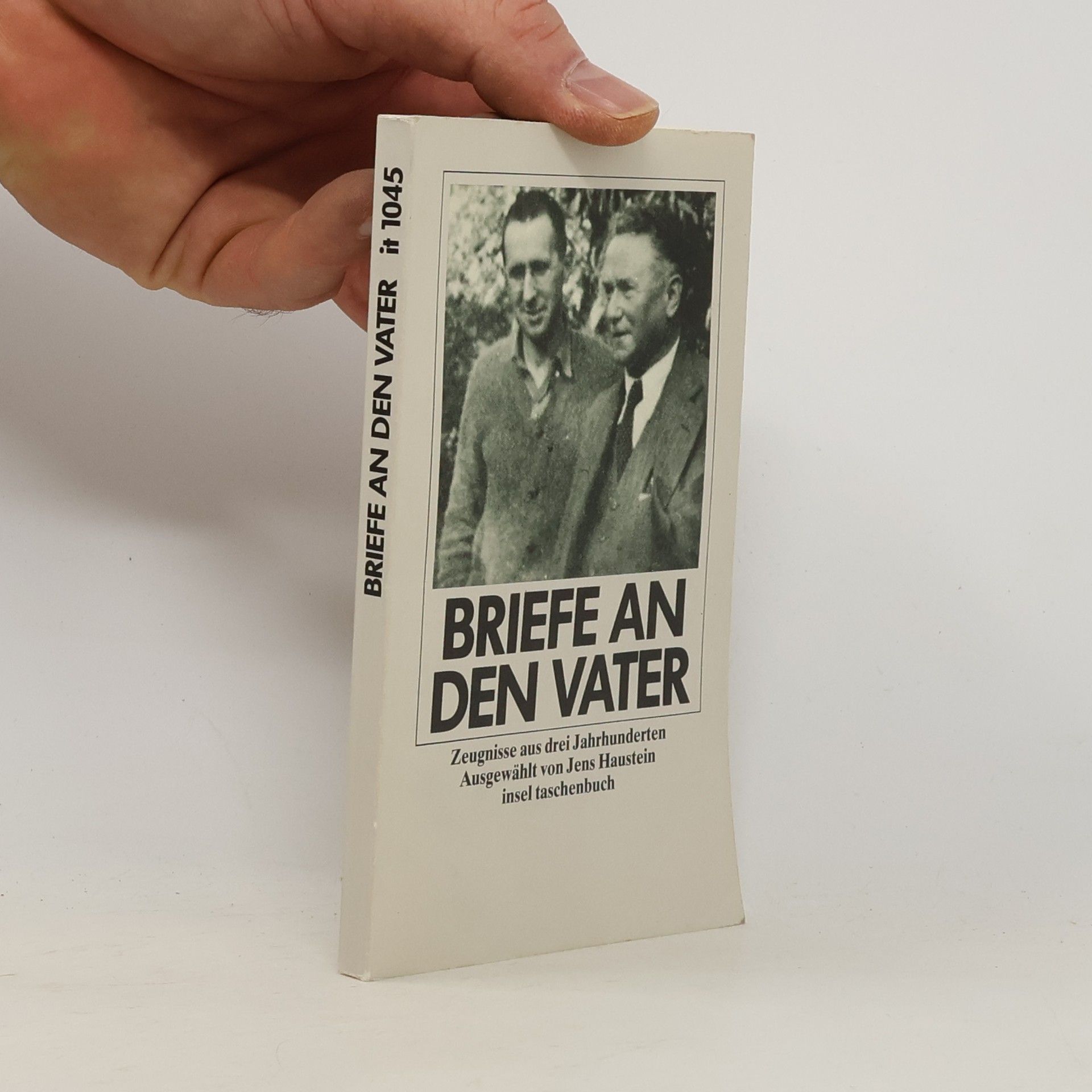


Erzählte Heiligkeit
Poetologische und funktionale Überlegungen zur Verslegende "Das Leben der heiligen Elisabeth" und zu Johannes Rothes "Elisabethleben"
- 18pages
- 1 heure de lecture
Unmittelbar nach dem Tod Elisabeths von Thüringen entstehen die ersten Viten im Rahmen des Heiligsprechungsprozesses. Besonders einflussreich war die 'Elisabeth-Vita' Dietrichs von Apolda, die den Sängerstreit auf der Wartburg mit der Elisabeth-Vita verknüpfte. Der Beitrag analysiert zwei volkssprachliche Elisabeth-Viten, die aufgrund ihres epischen Umfangs 'ins Erzählen geraten' und Elemente anderer Gattungen als der Hagiographie integrieren. Die um 1300 entstandene hessische Verslegende zeigt, wie der unbekannte Verfasser in Motivik, Wortwahl und Figurenzeichnung Anleihen beim höfischen Roman macht, was ein Interesse an höfischer Pracht und Kultur widerspiegelt, das dem Leben und Wirken Elisabeths entgegensteht. Diese Spannung spiegelt möglicherweise die Herausforderungen wider, die Elisabeth am Thüringer Landgrafenhof erlebt hat. Rund 100 Jahre später entstand Johannes Rothes Elisabeth-Dichtung, die sich stärker der Chronistik nähert und zahlreiche Passagen aus der Landesgeschichte aufgreift, die wenig mit Elisabeths Leben zu tun haben. Besonders betont wird das Leben und Wirken Ludwigs, Elisabeths Ehemann, sowie seines 'bösen' Nachfolgers Heinrich Raspe, der für Elisabeths Vertreibung und die Ermordung ihres Sohnes verantwortlich war. Klingsors Prophezeiung, dass Elisabeth dem Lande Thüringen dienen werde, konturiert sie als Landesmutter.