Cord Meckseper Livres
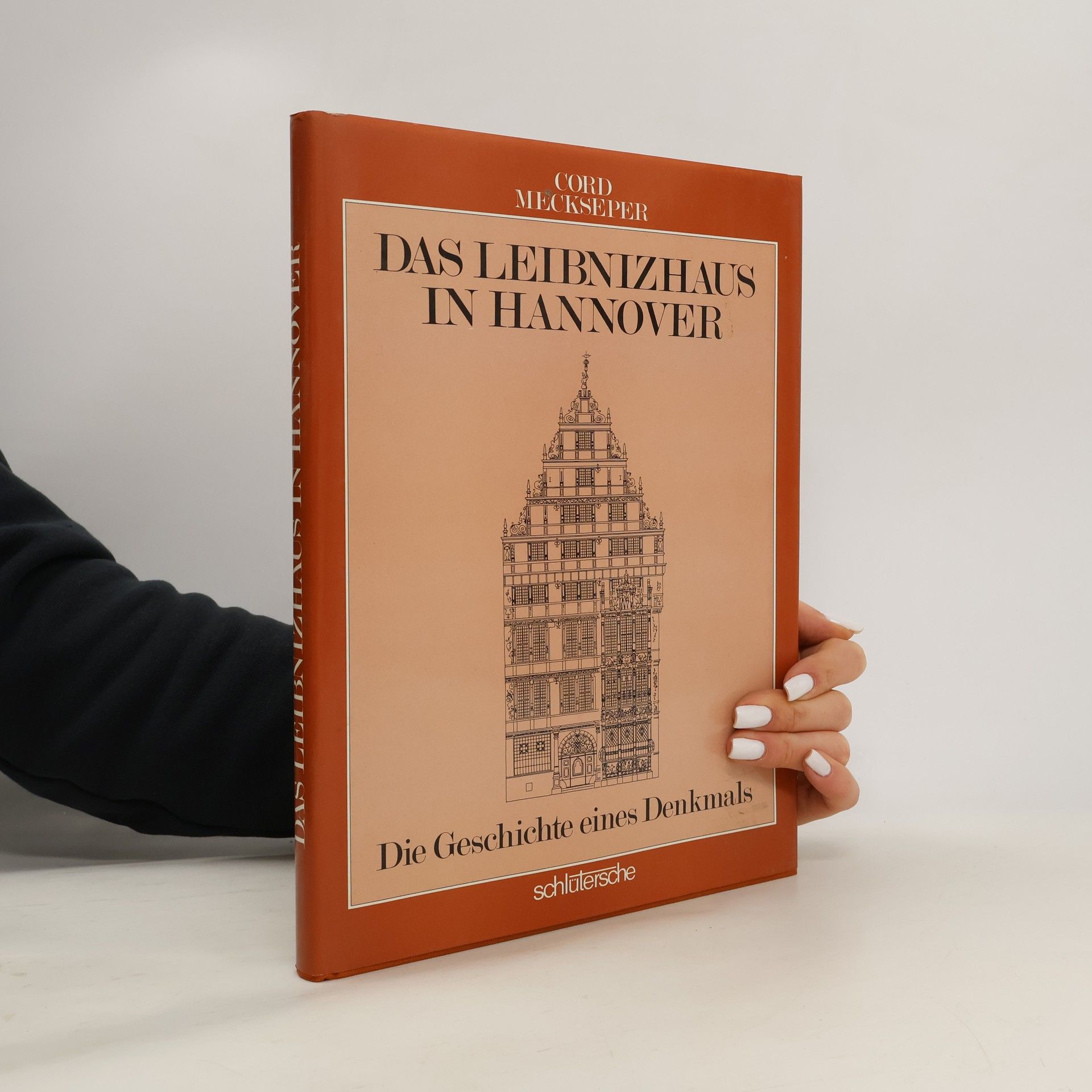


Wer die mittelalterliche Stadtbaugeschichte aus kunsthistorischer Sicht kennenlernen möchte, der sollte zu diesem handlichen Band greifen. Cord Meckseper zeichnet die wichtigsten Entwicklungslinien nach und nutz dabei auch die Ergebnisse von Historikern, Mittelalterarchäologen und Siedlungsgeographen. Er wendet sich zunächst dem städtischen Gesamtaufbau zu und verfolgt die Veränderungen des Stadtgrundrisses durch die Jahrhunderte. Die Städte der Kelten und Römer werden knapp skizziert. Im Zentrum des Interesses steht dann die Stadt zur Zeit der Franken, Ottonen, Salier und Staufer. Ein Ausblick auf die Erweiterungen der Städte im Hoch- und Spätmittelalter beschließt die Chronologie. Der zweite Teil des Bandes ist der Architektur der Stadt in ihren Einzelbauwerken gewidmet, wozu neben Befestigungen, Wohnbauten und Kirchen auch Gebäude mit Sonderfunktionen gehören, so z.°B. Wirtschaftsbauten, Ratshäuser, Schulen und technische Anlagen. Die Darstellung wird durchgängig von signifikanten Beispielen sowie Plänen, Aufrissen, Schnitten und Rekonstruktionszeichnungen begleitet.
German