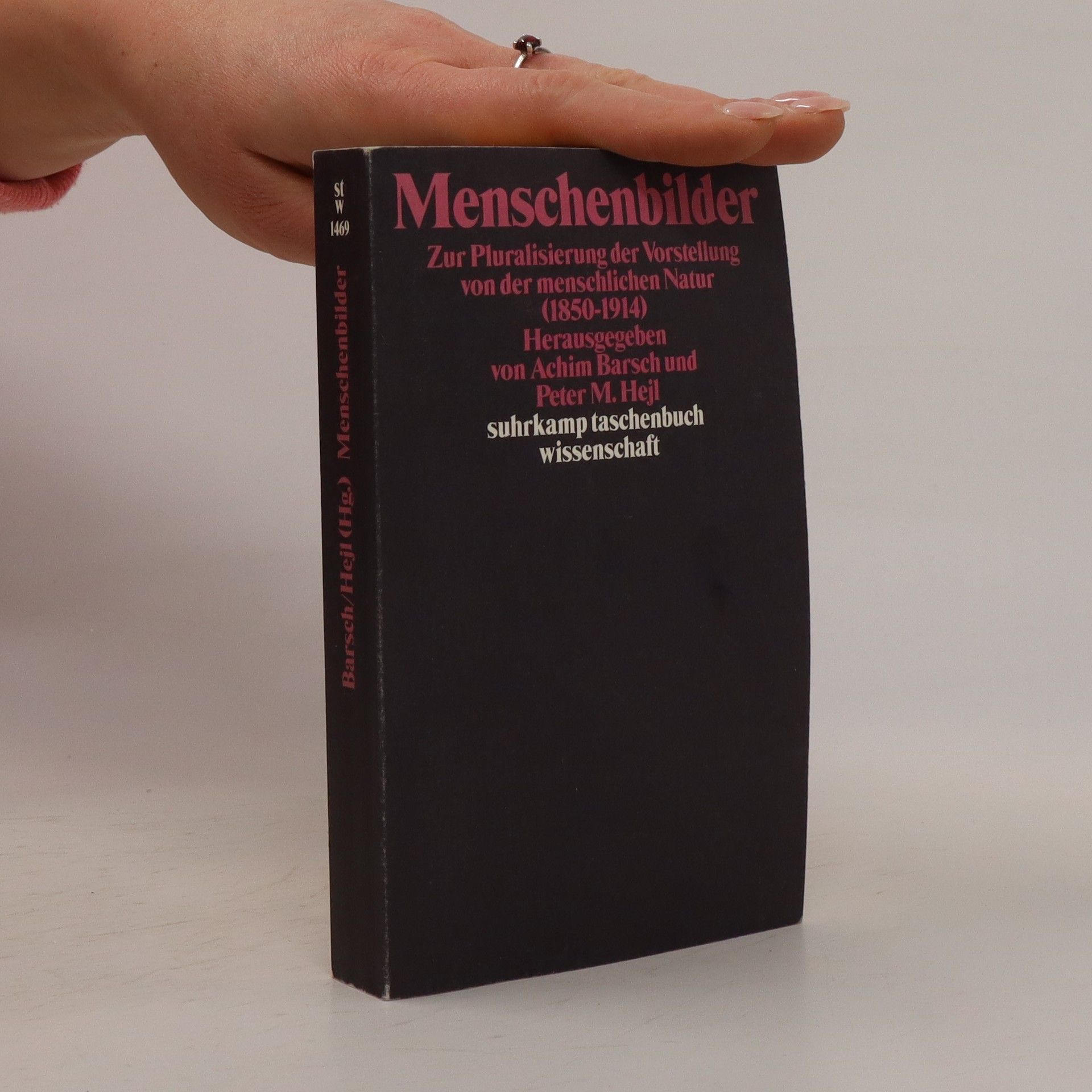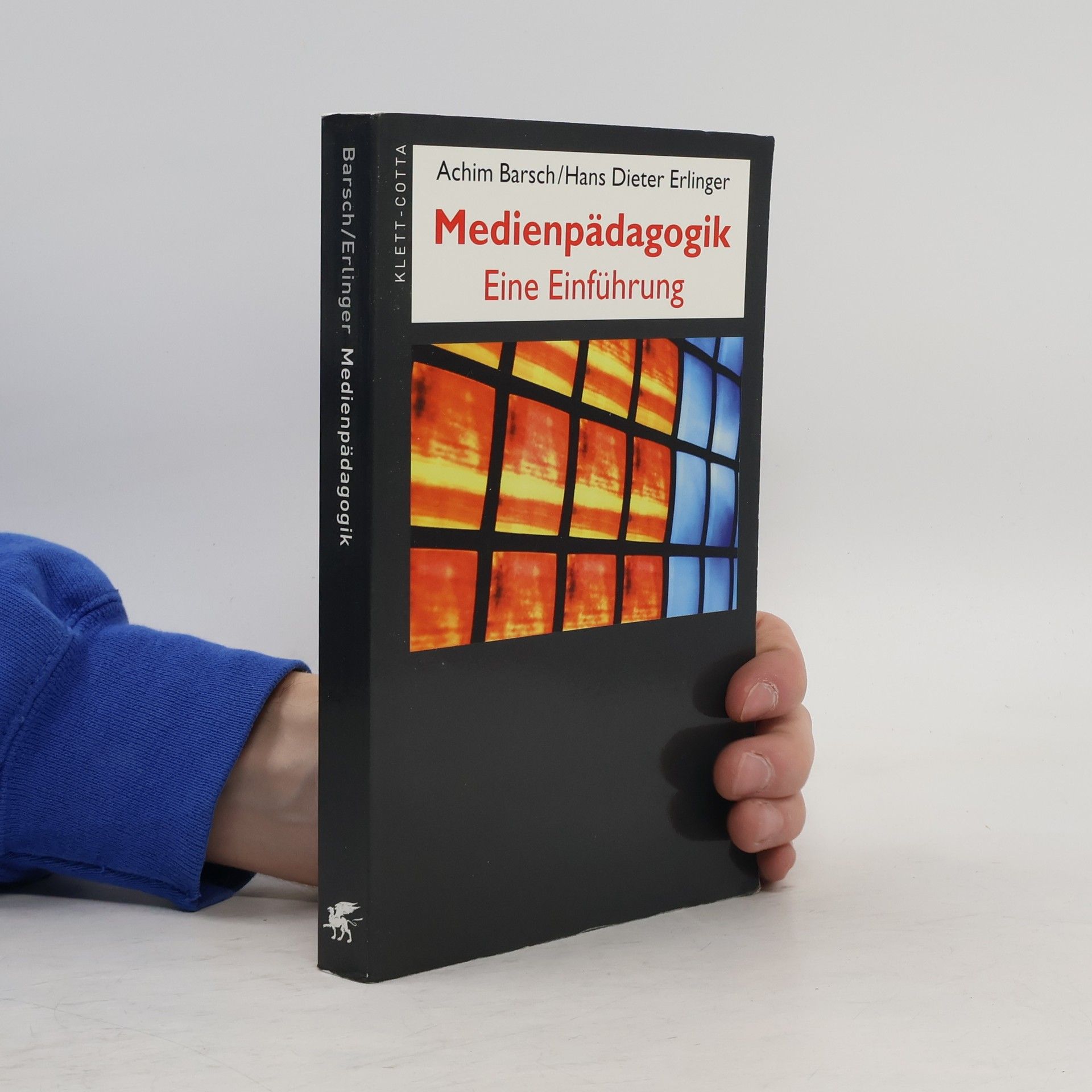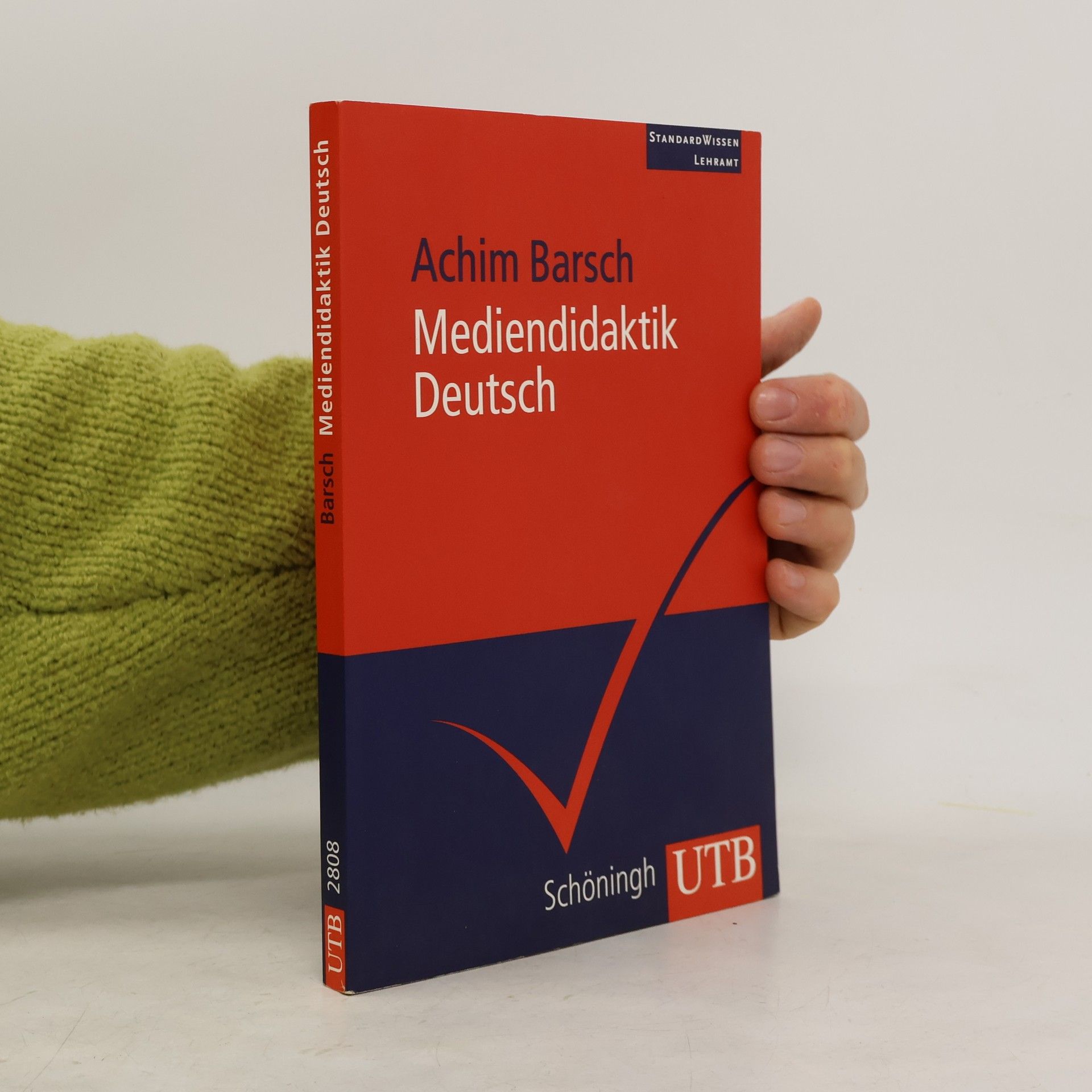Mediendidaktik Deutsch
- 230pages
- 9 heures de lecture
Mediendidaktiken gibt es viele - doch dieser Band der Reihe StandardWissen Lehramt bietet erstmals eine speziell auf die Erfordernisse des Deutschunterrichts zugeschnittene Einführung in jenes mediendidaktische Grundwissen, das fürs Unterrichten im Fach wirklich notwendig ist. Die durchgehende Didaktisierung inklusive Übungsfragen ermöglicht es dem Leser, sich mit diesem Buch optimal auf Klausuren und mündliche Prüfungen vorzubereiten.