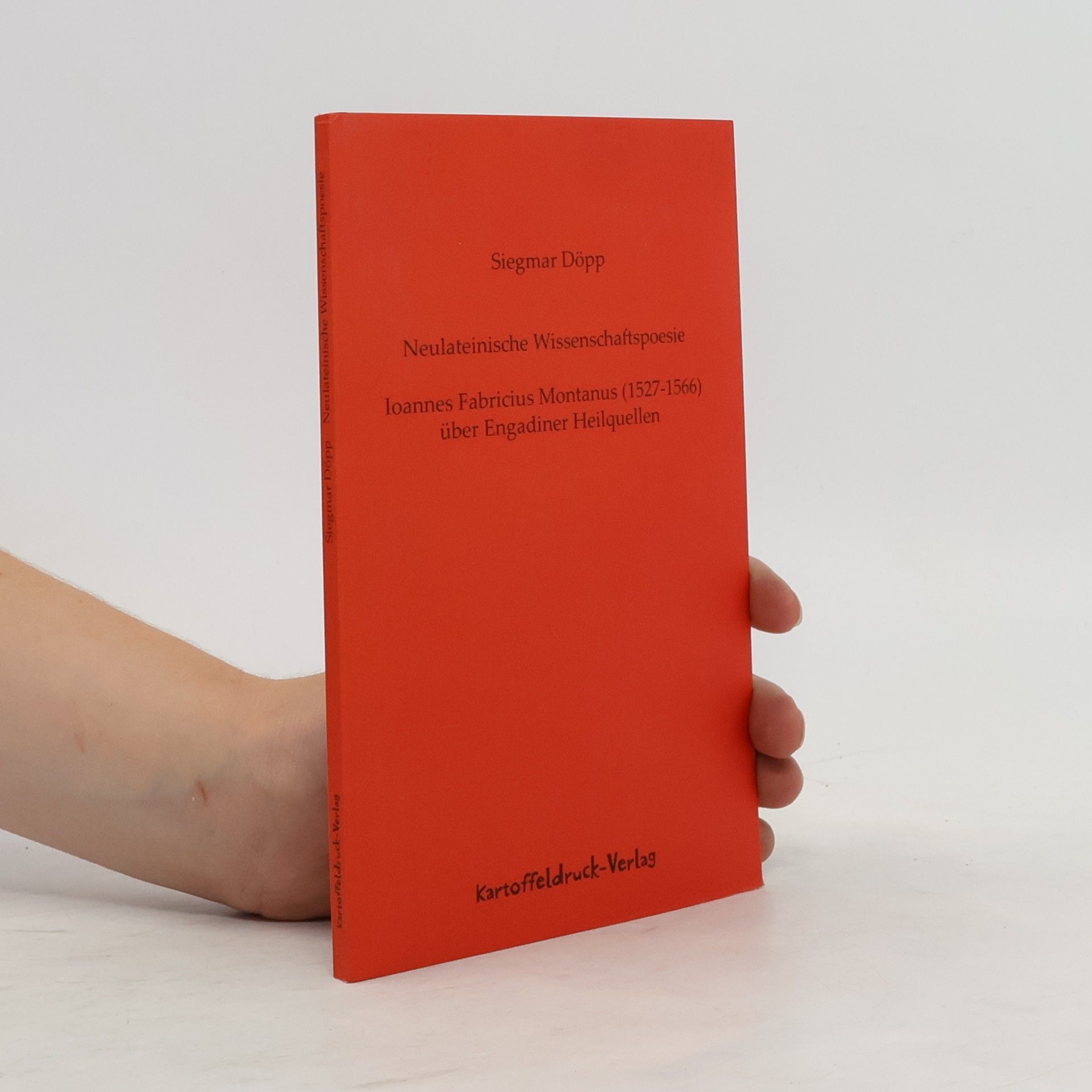Catulls Gedichte
Nachschrift einer Vorlesung von Prof. Moriz Haupt 1861/62
- 128pages
- 5 heures de lecture
Im Wintersemester 1861/62 hielt an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin (heute Humboldt-Universität) der Klassische Philologe und Germanist Moriz Haupt (1808-1874) eine Vorlesung über den römischen Dichter Catull (etwa 84-54 v. Chr.); darin folgte er den Spuren seines verehrten Lehrers Karl Lachmann (1793-1851), der eine seinerzeit vielbeachtete Catull-Ausgabe veröffentlicht hatte. Von Haupts Vorlesung im Wintersemester 1861/62 hat sich die anonyme Nachschrift eines Hörers erhalten, die nun erstmals zugänglich gemacht wird. Sie ist ein eindrucksvoller Beleg von Haupts mündlich vorgetragener Exegese Catullischer Gedichte.