In Die Kunst des Anfangs sind nach einer Einleitung über die Bedeutung des Erstgesprächs sowie das Setting und seine Implikationen zwölf psychoanalytische Erstgespräche dargestellt. In der hier vorgelegten Darstellung von Erstgesprächen lernt der Leser und junge Psychoanalytiker durch den Einblick in eine erste psychoanalytische Begegnung und die in ihr entstehenden Übertragungsangebote die Empfindungen und Gedanken des Psychoanalytikers - seine wichtigsten Werkzeuge - kennen. Die ganzheitliche Wiedergabe der psychoanalytischen Erstgespräche hat den Sinn, psychoanalytisches Denken und psychoanalytische Arbeit zu vermitteln.
Anita Eckstaedt Livres
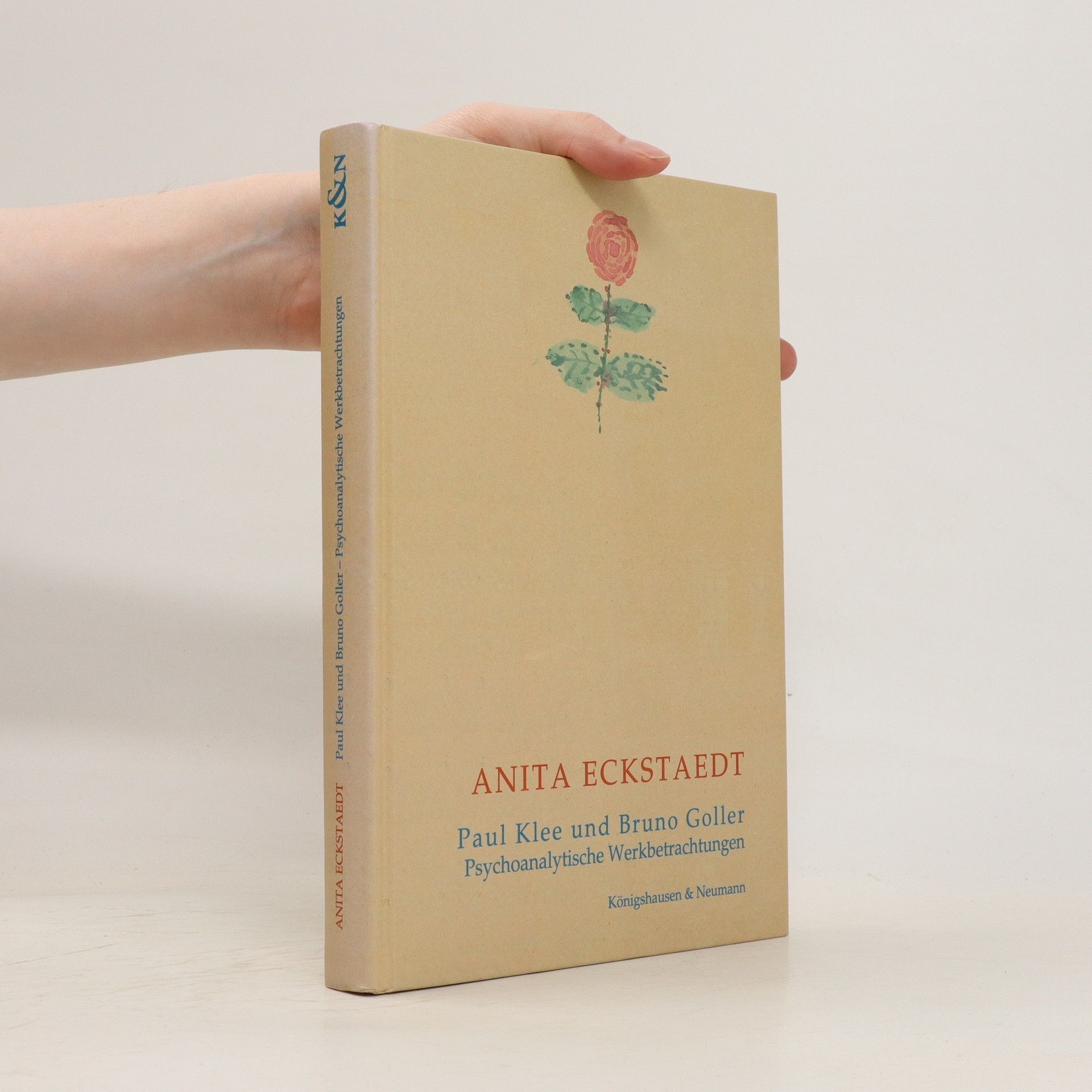


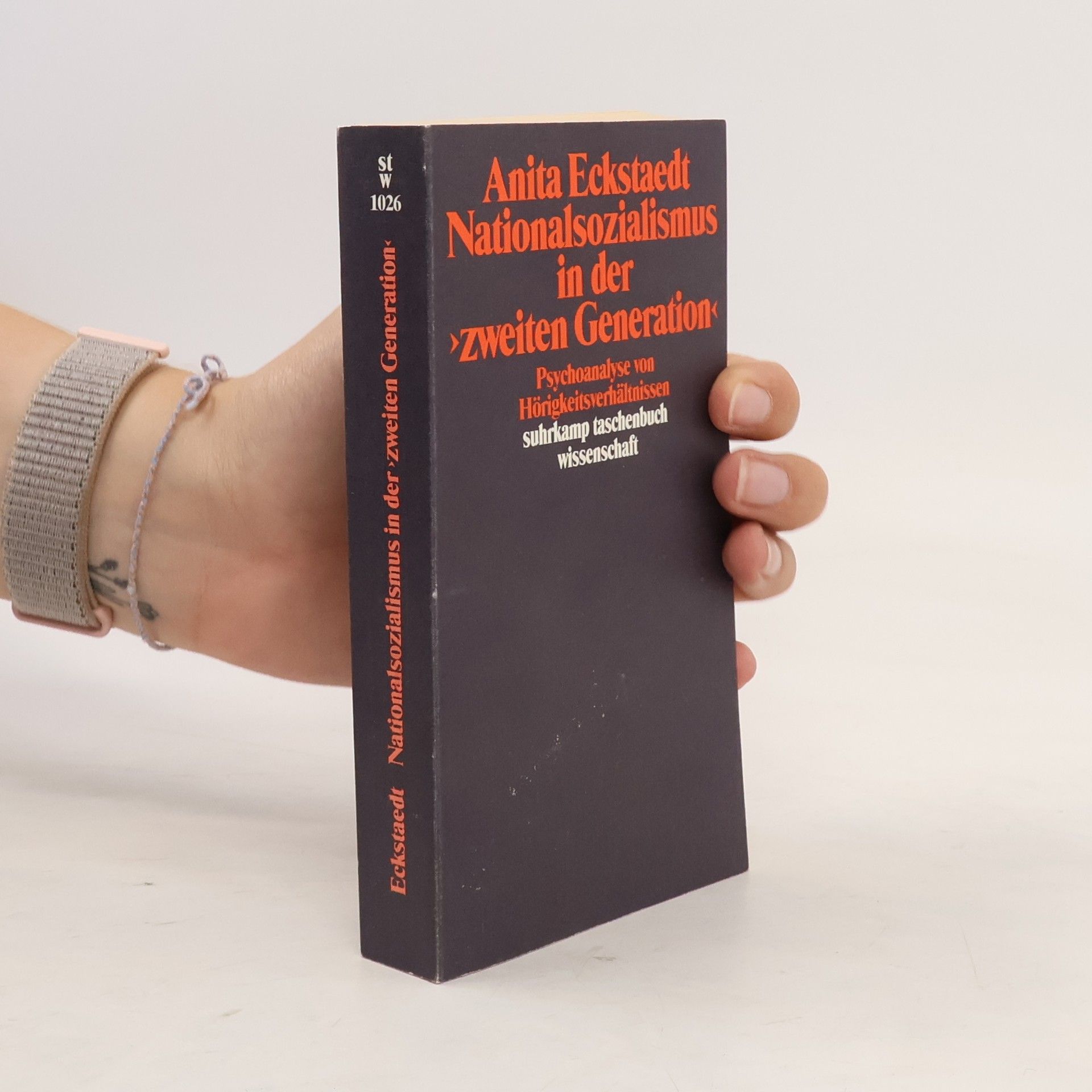
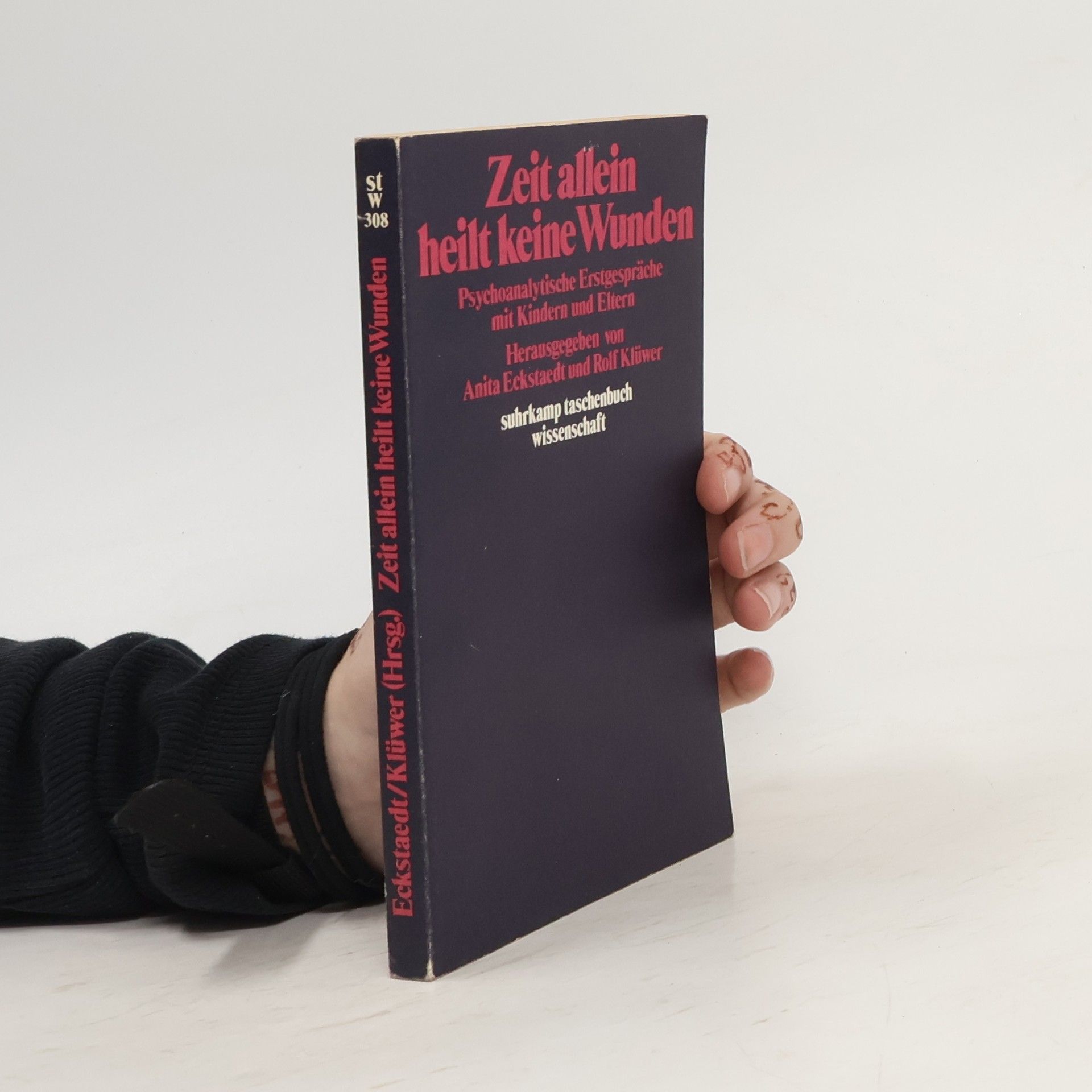
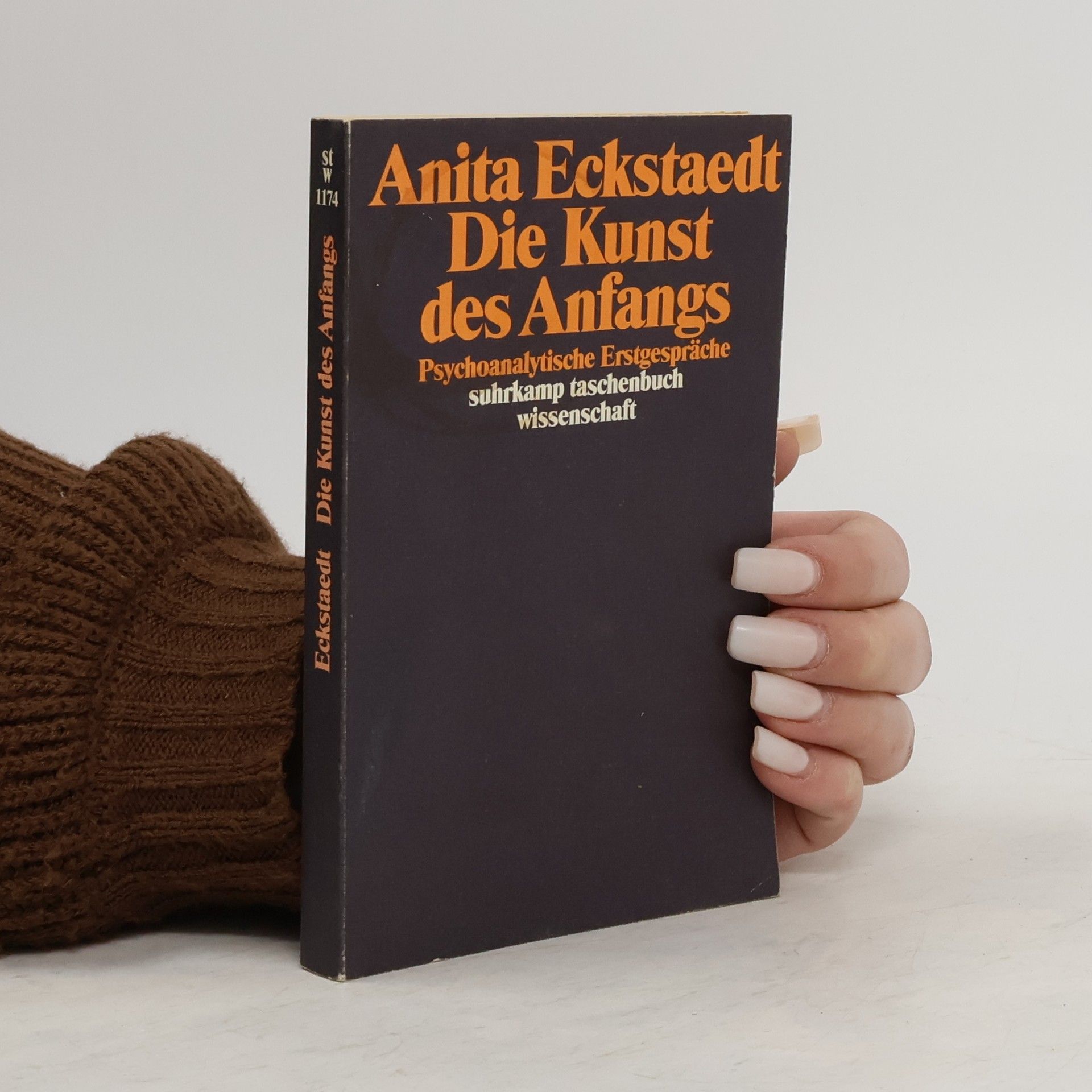
German
Nationalsozialismus in der "zweiten Generation"
- 515pages
- 19 heures de lecture
Thema dieser aufschlussreichen Arbeit sind die Auswirkungen der Faschismus-Epoche und des Zusammenbruchs des »Dritten Reiches« auf die psychische Entwicklung der während des Krieges oder unmittelbar danach geborenen Kinder der Täter. Anita Eckstaedt wagt sich auf ein Terrain, das von der westdeutschen Psychoanalyse bislang weitgehend vernachlässigt wurde. Ihre Analyse der psychischen Deformationen, die aus der Ideologie des Nationalsozialismus resultieren und bis heute wirken, ist ein bedeutender Beitrag zur Aufklärungs- und Trauerarbeit, die von der Nachkriegsgeneration unterlassen wurde. Eckstaedts Untersuchung ist gleichwertig neben den Arbeiten von Alexander und Margarete Mitscherlich zu betrachten. Während deren sozialpsychologische Analyse der Abwehr- und Verleugnungsmechanismen eine eher soziologische Perspektive einnimmt, entwickelt Eckstaedt die Problematik aus der psychoanalytischen Behandlungsrealität. Dadurch wird deutlich, wie die strukturell beschriebenen Phänomene und Symptome der Kriegsgeneration konkret die psychische Entwicklung der »zweiten Generation« beeinflusst haben. (Joachim Weiner) 1991 hat Eckstaedt im Suhrkamp Verlag veröffentlicht: Die Kunst des Anfangs. Psychoanalytische Erstgespräche.
Erinnern allein reicht nicht
Nachwirkungen der NS-Ideologie wahrnehmen und verstehen
Die nationalsozialistische Ideologie blieb nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs für etliche Deutsche mental führend. Wegschauen, Schweigen, Verneinen, Verleugnen und Vergessen-Machen dienten gegenüber der Demokratisierung als Abwehrformen. Ebenso sollte damit eine Schuldaufdeckung verhindert werden. Während im öffentlichen Raum mittels Mahn- und Gedenkmalen sowie in politischen Reden zunehmend an die Gräueltaten der Vergangenheit erinnert wurde, sollte Erinnerung im privaten Raum dagegen gelöscht werden. In dieser Weise wurde die Gefahr des Rechtsextremismus andauernd und weit unterschätzt. Doch das Wissen um die während des »Dritten Reichs« geschehenen Verbrechen setzte sich transgenerational in den nächsten Generationen fort. Trotz ihrer eigenständigen Aufklärung litten die Kriegskinder und Folgegenerationen unter dieser Weitergabe des so gefühls- und schuldbelasteten Erbes, sodass sie dadurch auch eine Prägung erfuhren. Das Anliegen von Anita Eckstaedt ist ganz allgemein die Wahrnehmung für verbliebene Phänomene der NS-Ideologie zu sensibilisieren, um letztlich ähnlichen Entwicklungen von Destruktivität entgegentreten zu können. Dementsprechende Anzeichen oder Einstellungen werden in ihren Zusammenhängen durch die in Analysen gewonnenen Erkenntnisse aufgezeigt. Diese Orientierung ermöglicht auch jenseits des psychoanalytischen Behandlungsraums ein leichteres sowie frühes Erkennen solcher Gefahr.
Der Ursprung des Schöpferischen bei Paul Klee
- 149pages
- 6 heures de lecture
Es ist ein Glücksfall, dass Paul Klees Kinderzeichnung Mimi, die Mme. Grenouillet einen Blumenstrauß überreicht, 1883 erhalten geblieben ist. Diese Zeichnung, verbunden mit einem Bilderbogen aus Épinal, führt zu den Phantasien des damals Vierjährigen. Die dargestellte Mutter-Kind-Beziehung wirkt auf den ersten Blick entzückend, doch eine subtile Analyse entschlüsselt die dahinterstehende Dramatik. Klees schöpferische Kraft ermöglicht es ihm, frühzeitig aus Konflikten auszubrechen und in der Welt der Bilder zu leben. Anita Eckstaedt untersucht, ob diese Zeichnung von Mimi eine Selbstdarstellung ist und fragt nach späteren Selbstbildnissen Klees. In ihrer psychoanalytischen Studie entdeckt sie in seinen Bildern sowohl den Zweifel an seiner Identität als Maler als auch Spuren früherer Konflikte. Die Suche nach einem „guten Objekt“ führt zu Malereien, die Erinnerungen enthalten und in distanzierende Abstraktionen übergehen: Klees eigene und neuartige Welt. Auch Nicht-Analytiker haben in diesem Buch die Möglichkeit, psychoanalytisches Wahrnehmen und Verstehen Schritt für Schritt nachzuvollziehen, ähnlich wie in einer Behandlung. Die Reichweite dieser subtilen Sichtweise ist nicht nur unerwartet, sondern auch außergewöhnlich und staunenswert.
Paul Klee und Bruno Goller
- 351pages
- 13 heures de lecture
Die Einleitung des Buches stellt die parallele Entwicklung der Moderne und der Psychoanalyse und ihre beiderseitige Verschränkung heraus und zeigt die Subjektivität des Künstlers auf, die die tradierten Stilepochen ablöst. In zwei gegenübergestellten Werkanalysen von Paul Klee und Bruno Goller wird den Entwicklungen in ihren Werken gefolgt. In Einzelschritten entstehen spannende und genaue Beschreibungen formaler und inhaltlicher Beobachtungen wesentlicher Arbeiten. Deutungsketten mit der Aufnahme sich wiederholender und verändernder Merkmale führen zu Zusammenhängen, die sich schließlich zu einem Gesamtverständnis ordnen. So kann es gar nicht anders sein, dass dieses psychoanalytische Verständnis des Werkes auch als Ausdruck der Persönlichkeitsstruktur zu sehen ist: Paul Klee und Bruno Goller haben jeweils völlig konträre Lösungen für den Umgang mit ihren Konflikten entwickelt Konflikte, die aus den Schicksalen mit ihren Müttern entstanden sind. Die Verarbeitungsform spiegelt sich letztlich in ihren Werken wider, nämlich die philobatische beziehungsweise oknophile Haltung wie sie 1958 der Psychoanalytiker Michael Balint beschrieb.