"Glück ist eine Auster“ spielt in einer undurchsichtigen Filmbranche, die vom Niedergang bedroht scheint und sich doch wieder neu erfindet. Ein Produzent will seinen letzten Coup landen und sein Drehbuchautor kann immer weniger zwischen erlebter und imaginierter Realität unterscheiden, zwischen seiner Liebessehnsucht und einer schleichenden Drogenparanoia.
Martin Hennig Livres
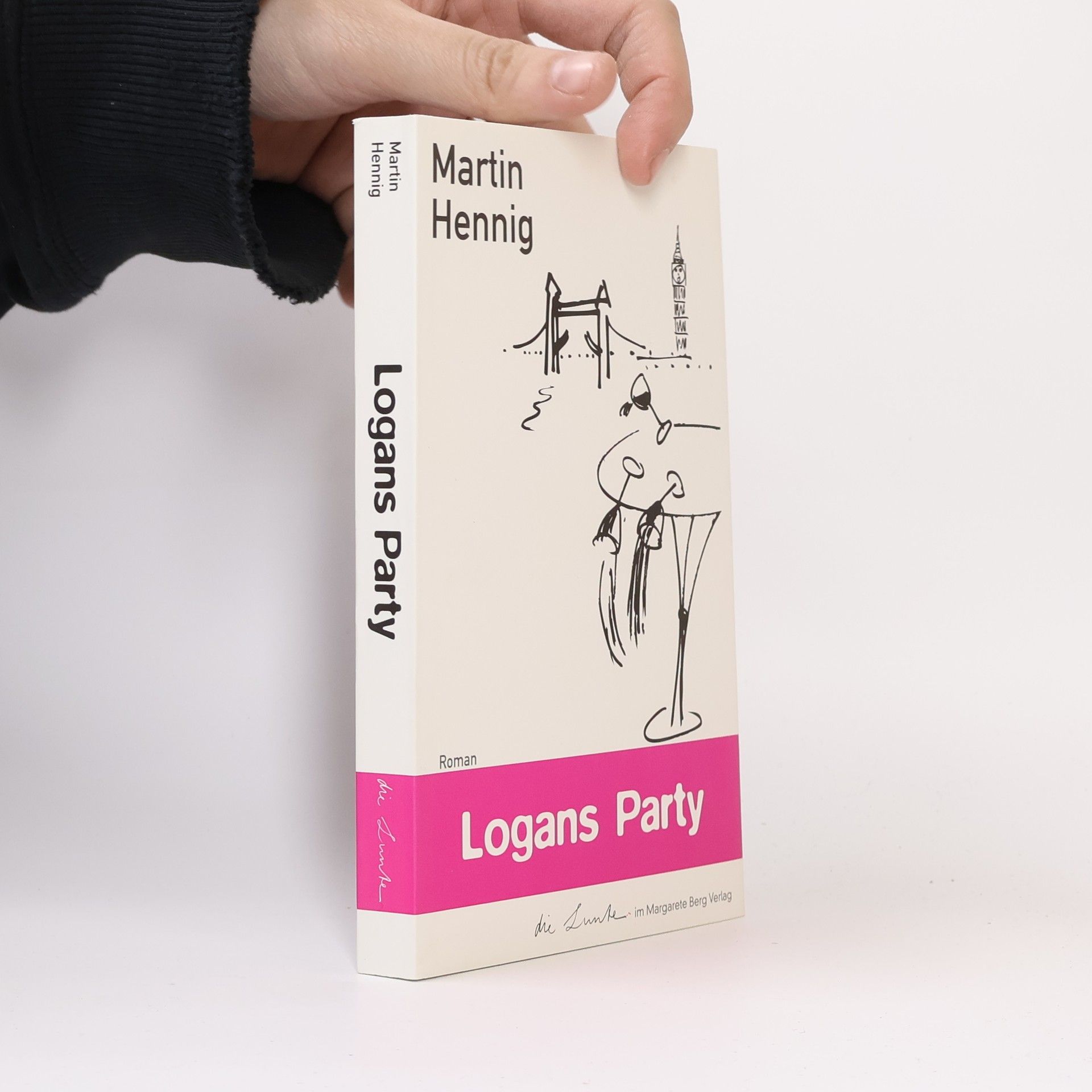


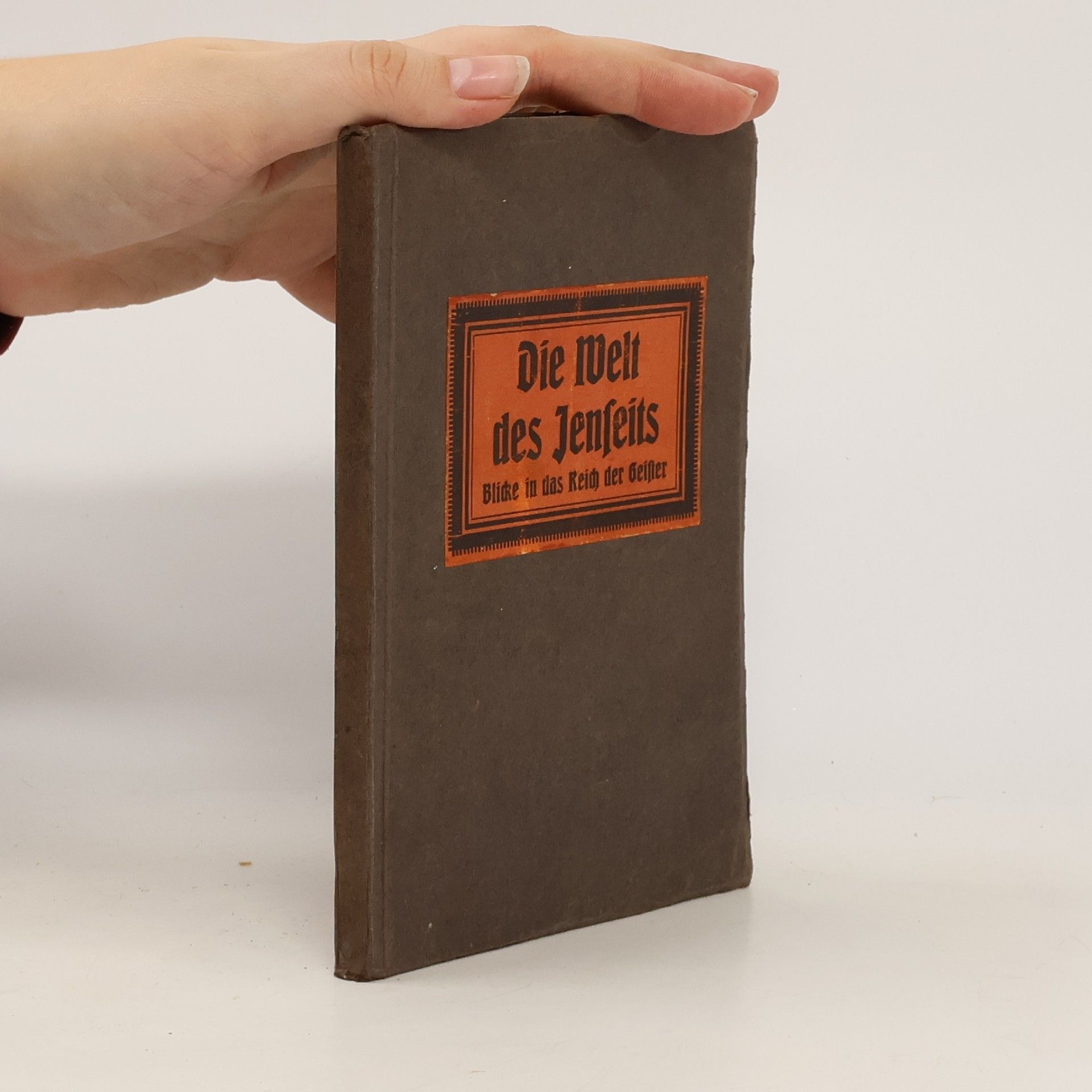

Mediale Phänomene des Horrors sind heutzutage so en vogue wie vielleicht noch nie. Trotz ihrer Masse und Aktualität – bei einer gleichzeitig reichhaltigen historischen Tradition – werden sie in der akademischen Forschung eher stiefmütterlich behandelt. Diese Publikation widmet sich deshalb erstmals aus einer breiten, medienkulturwissenschaftlich ausgerichteten Perspektive den wechselseitigen Einflussnahmen und Interferenzen von Medien, Horror und Räumlichkeit. Denn die Bedrohungsszenarien und kulturellen Bedeutungen des Horrorgenres lassen sich seit seinen Ursprüngen auf spezifische mediale Strategien im Umgang mit Räumlichkeit zurückführen: So stellt sich die Frage nach wiederkehrenden Topographien des Horrors (Friedhöfe, Krankenhäuser, Psychiatrien oder Laboratorien…) und den gesellschaftlichen Diskursen, die in diesen symbolischen Orten kulminieren. Darüber hinaus betrachtet der Sammelband aus interdisziplinärer Perspektive die historisch, kulturell und je nach Medium (Film, Comic, Computerspiel…) unterschiedlichen Inszenierungsweisen räumlicher Konstellationen. Schließlich lässt sich Horror auch auf theoretischer Ebene räumlich beschreiben, etwa in Bezug auf Grenzüberschreitungen in Bezug zum Raum der Normalität. Aus dieser Perspektive leisten die Autor*innen eine Relektüre etablierter theoretischer Ansätze.
Spielzeichen IV
Genres – Systematiken, Kontexte, Entwicklungen
Die Geschichte des digitalen Spiels hat eine beträchtliche Genrevielfalt hervorgebracht. Dabei werden Medienspezifika digitaler Spiele über Genres anschaulich. Sie lenken den Blick auf Verhältnisse von Schema und Variation, Strategien der Selbstreferenzialität und -reflexivität, Muster und Stereotypisierungen und die Einbettung digitaler Spiele in mediale und diskursive Systeme. Gleichzeitig sind die Grundlagen von spielerischen Genresystemen Gegenstand anhaltender Diskussionen, speist sich das Medium doch simultan aus spielerischen wie transmedialen Genretraditionen (etwa aus filmischen Genresystemen) – und dies auf spielmechanischen, erzählerischen und sozialen Dimensionen. Dieser Band gibt einen Überblick über den aktuellen Stand spielerischer Genredebatten. Dabei werden bestehende Genresystematiken auf ihre Ordnungssysteme und Wissensbedingungen hinterfragt, spielerische Genresysteme im Vergleich mit Genrekontexten und -konzepten anderer Medien näher bestimmt und der analytische Mehrwert von Genreüberlegungen für die Game Studies auf verschiedenen Ebenen dargestellt.