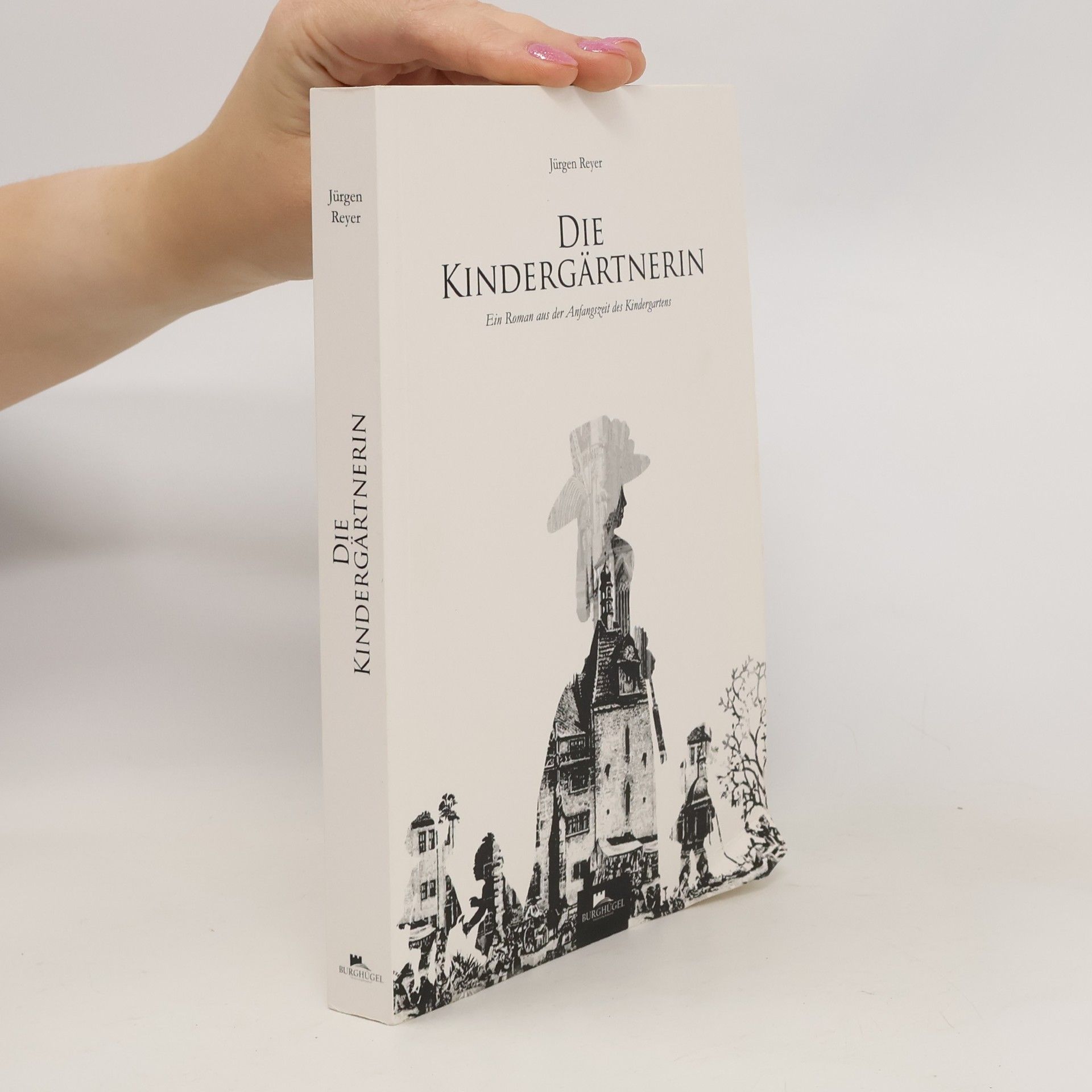Für Friederike Nachtigal, eine junge Frau aus bürgerlichem Hause, scheint sich ihr Lebenstraum zu erfüllen, als ihr die Leitung des Erfurter Kindergartens angeboten wird. Sie lebt Mitte des 19. Jahrhunderts in der Reaktionszeit nach den gescheiterten Revolutionen der Jahre 1848 und 1849 und hat einen der ersten modernen Frauenberufe ergriffen. Bei Friedrich Fröbel in Marienthal ließ sie sich zur Kindergärtnerin ausbilden, doch der behördliche Weg zur Genehmigung der Übernahme des Kindergartens ist steinig. Nachdem alle Hürden genommen sind, widmet sich Friederike mit Hingabe ihrer Arbeit mit den Kindern und genießt gesellschaftliches Ansehen. Sie ahnt nicht, dass sie bereits ins Intrigen-Netz der preußischen Geheimpolizei geraten ist. Die Handlung der Geschichte spielt in Thüringen, dem Heimatland des Kindergartens, insbesondere in den Städten Rudolstadt, Gotha, Erfurt und Nordhausen.
Jürgen Reyer Livres
1 janvier 1943