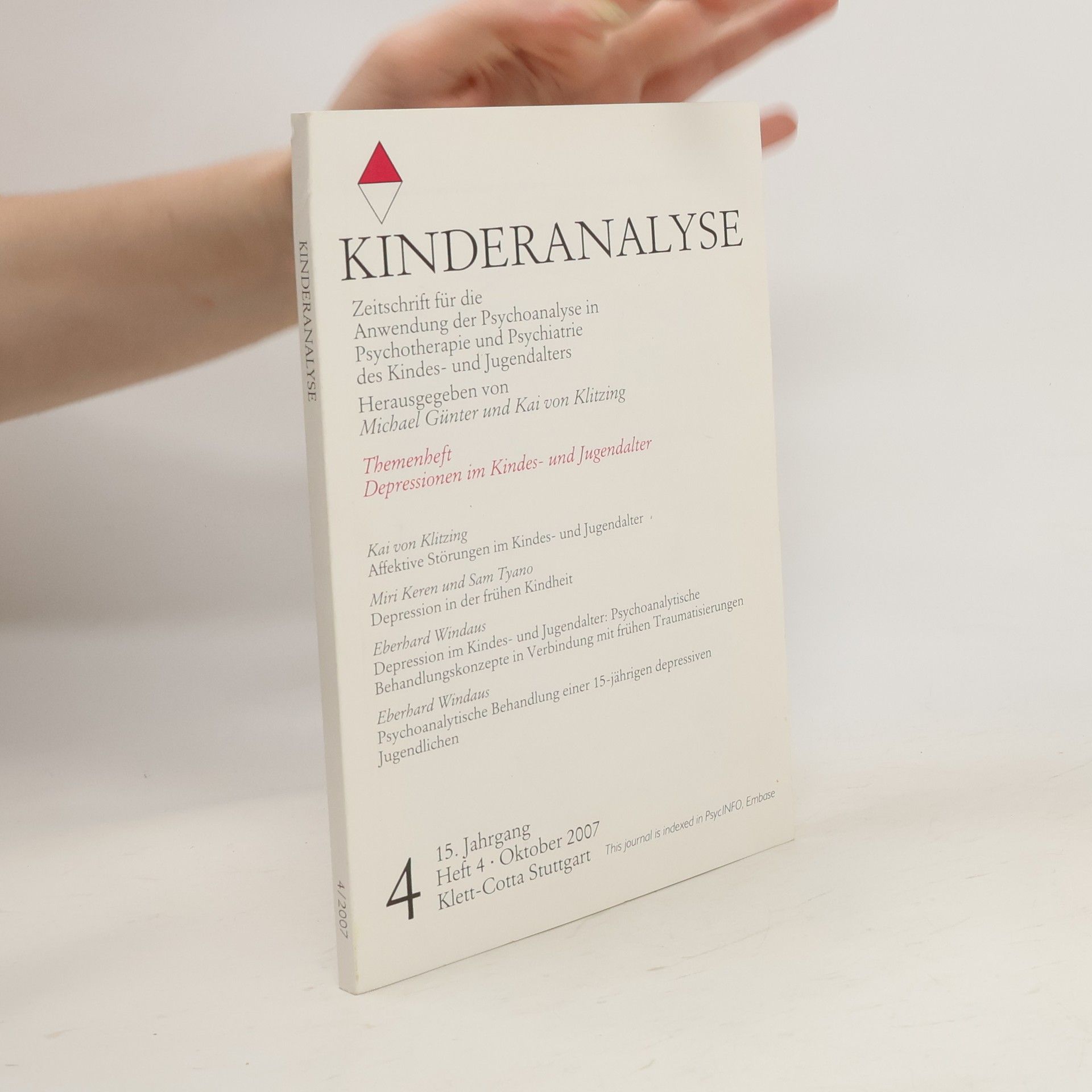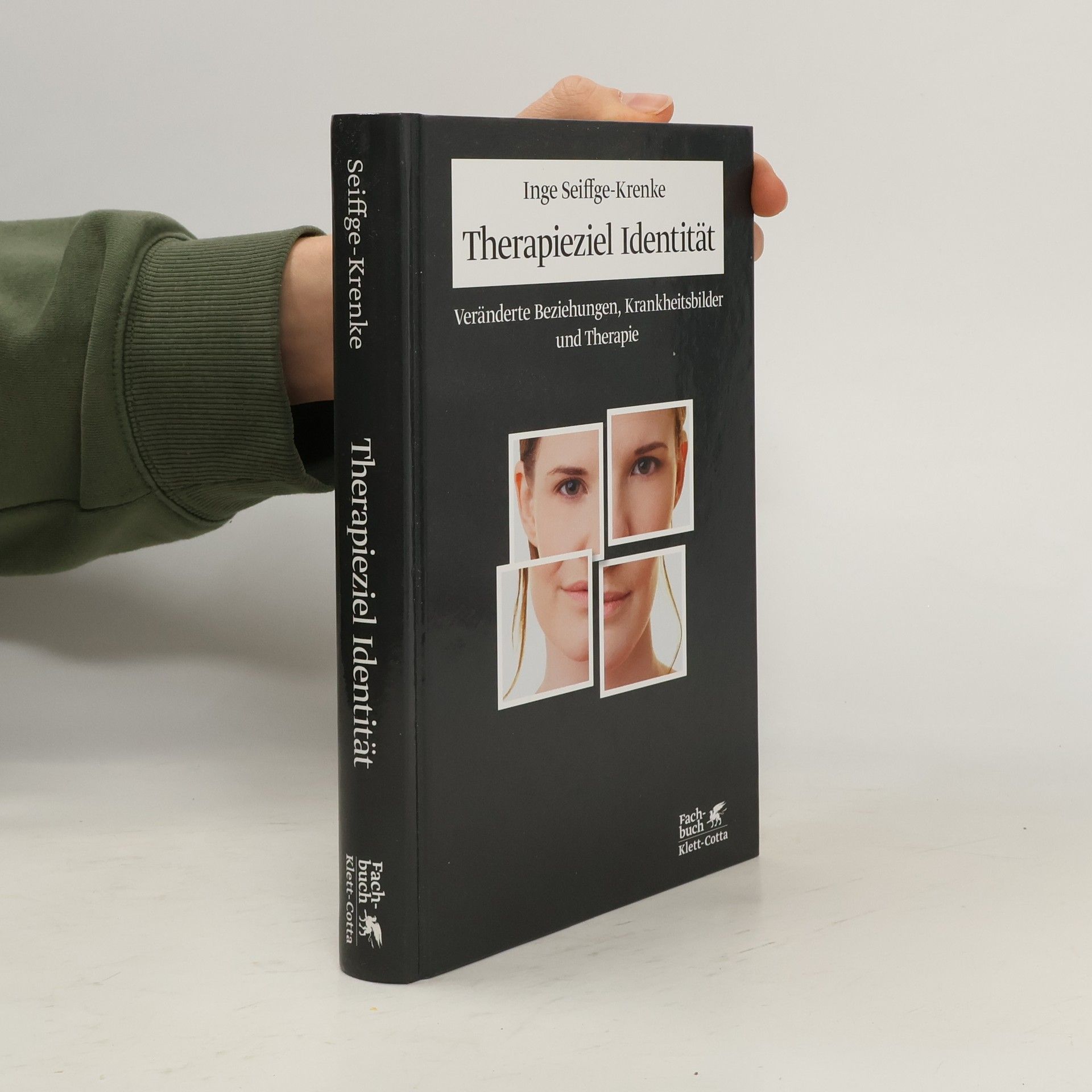Psychodynamische Psychotherapie mit jungen Erwachsenen
Besonderheiten der Entwicklungsphase "emerging adulthood"
- 208pages
- 8 heures de lecture
Das Buch beschäftigt sich mit den besonderen Merkmalen der neu entdeckten Entwicklungsphase "emerging adulthood", zeigt auf, was sich in den letzten Jahren verändert hat in Bezug auf Identitäts- und Beziehungsentwicklung und welche Konsequenzen sich daraus für die Behandlungstechnik ergeben. Junge Erwachsenen haben nicht nur sehr hohe Prävalenzraten psychischer Störungen, sie stellen sich auch in besonderer Weise bereits beim Erstgespräch dar: Es geht um Beeinträchtigungen im Lieben, Arbeiten und in der Autonomie. Die Instabilität ihrer Lebenssituation kann Anlass für Veränderungen im Rahmen, die noch andauernde Abhängigkeit von den Eltern Anlass zur Elternarbeit in dieser Altersgruppe sein.