Ca. 2 Millionen Menschen leiden an einer Zwangserkrankung – meistens nicht ein Leben lang, aber über viele Jahre. Sie müssen zwanghaft putzen, waschen, kontrollieren oder sammeln. Dieser Ratgeber beschreibt die Symptome der Zwangserkrankung und vermittelt praktisch, was man dagegen unternehmen kann. Die Autoren zeigen, wie leicht der Zwang sich als trickreicher Mitbewohner im eigenen Haus breit macht: Zunächst als nützlicher Ordnungshelfer hereingelassen, gewinnt er schnell die Überhand und diktiert das weitere Leben. Erklärt wird, wie Zwangserkrankungen entstehen und was sie am Leben erhält. Anschaulich und leicht verständlich vermitteln die Autoren Techniken, die in der Verhaltenstherapie erfolgreich angewandt werden und sehr gut zur Selbsthilfe genutzt werden können.
Susanne Fricke Livres
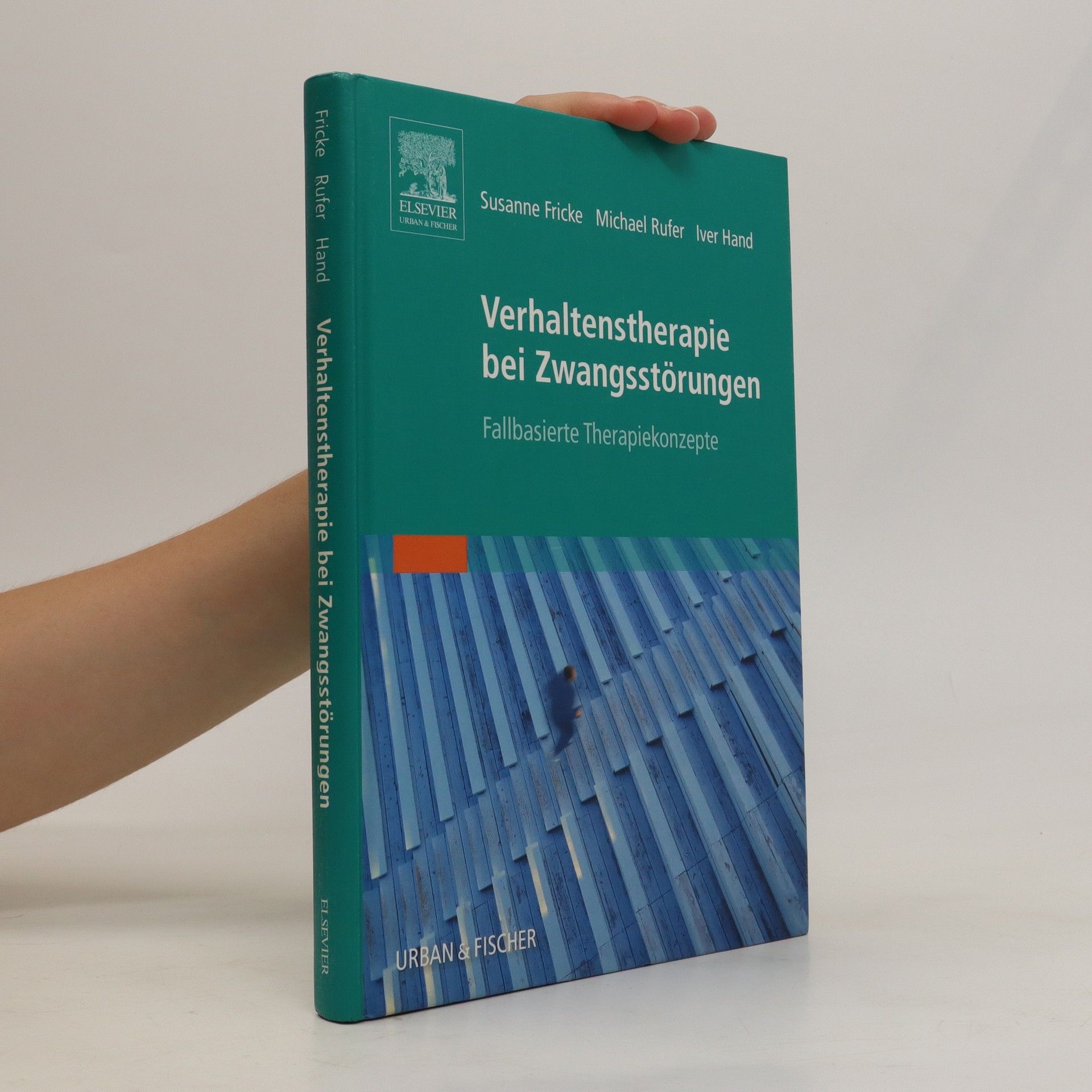
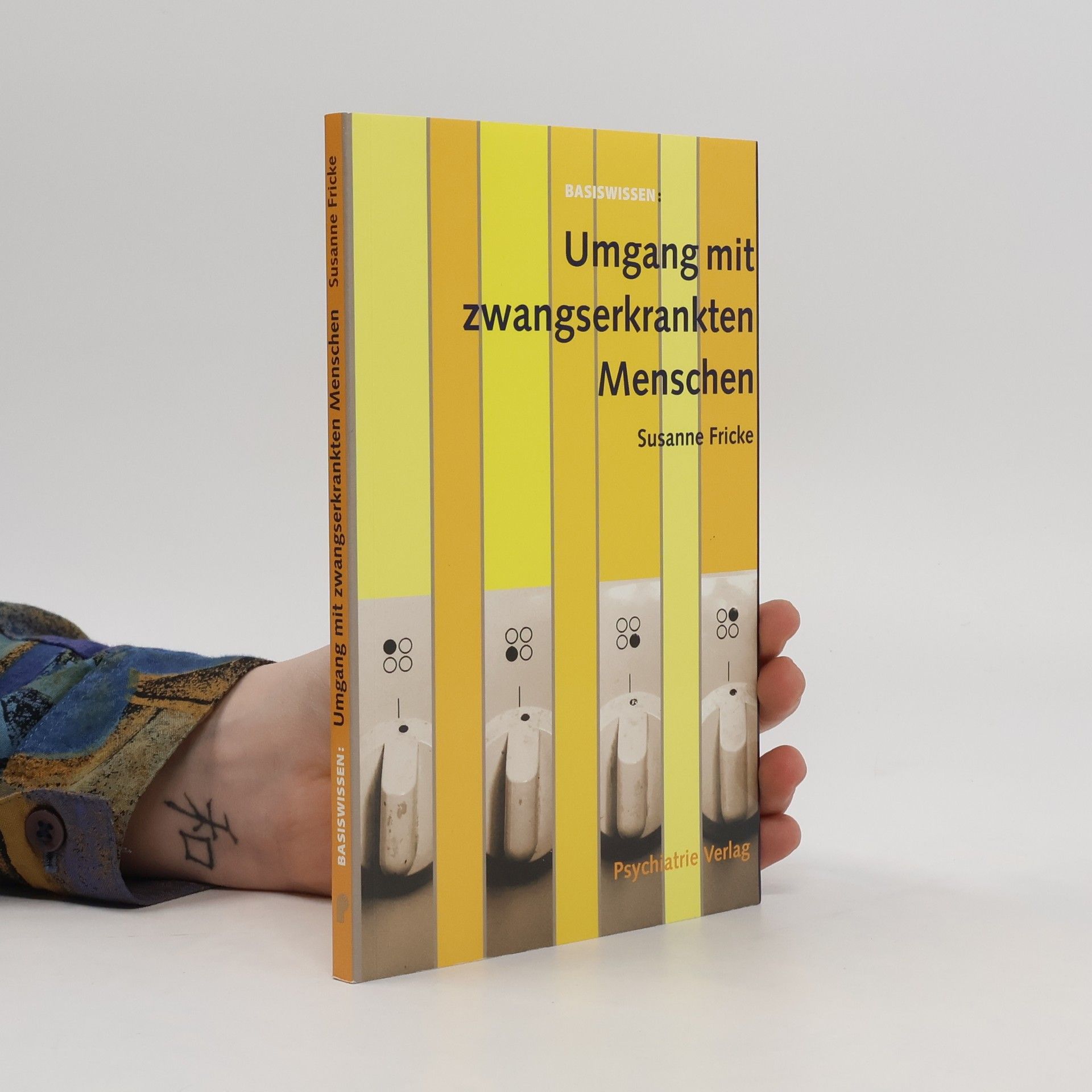


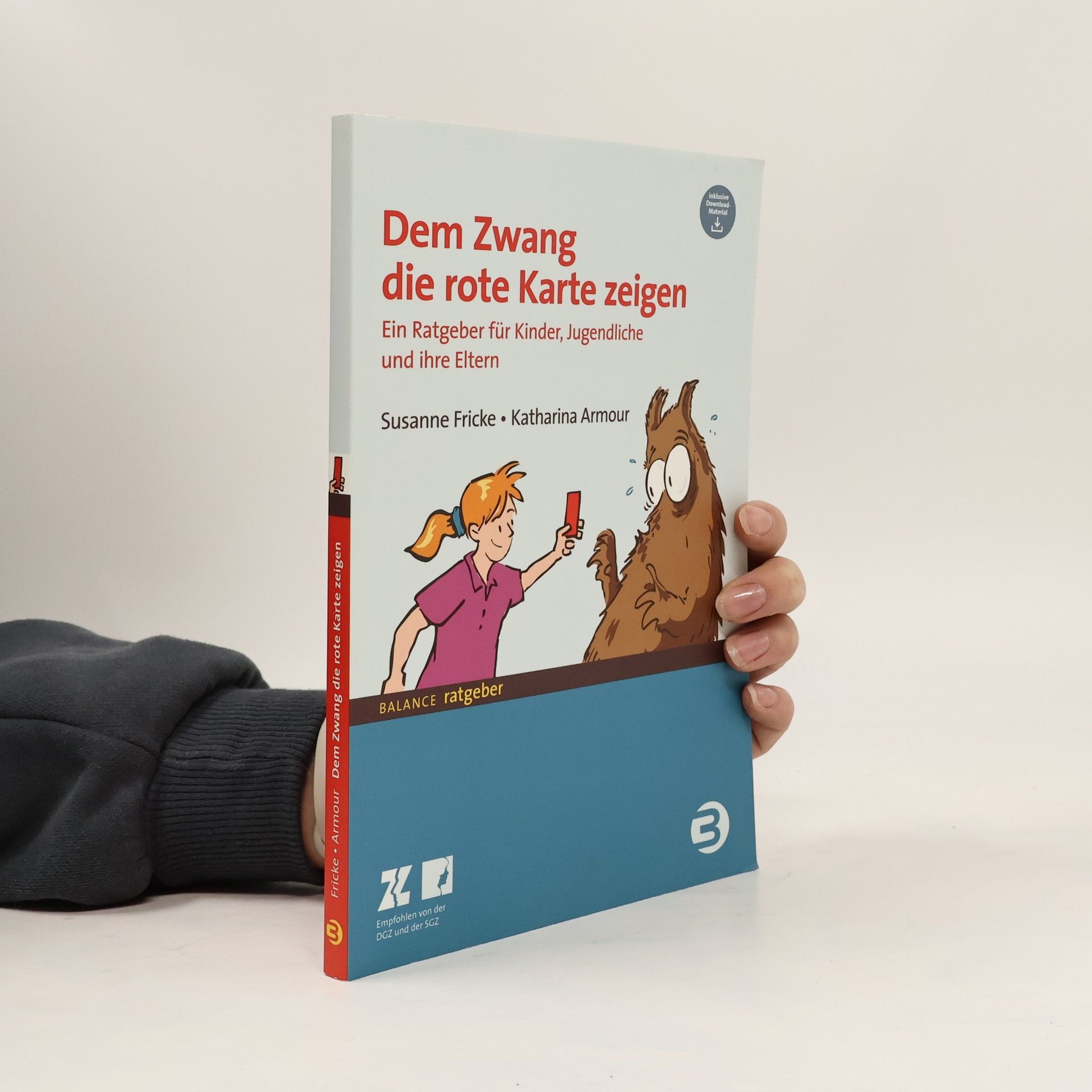
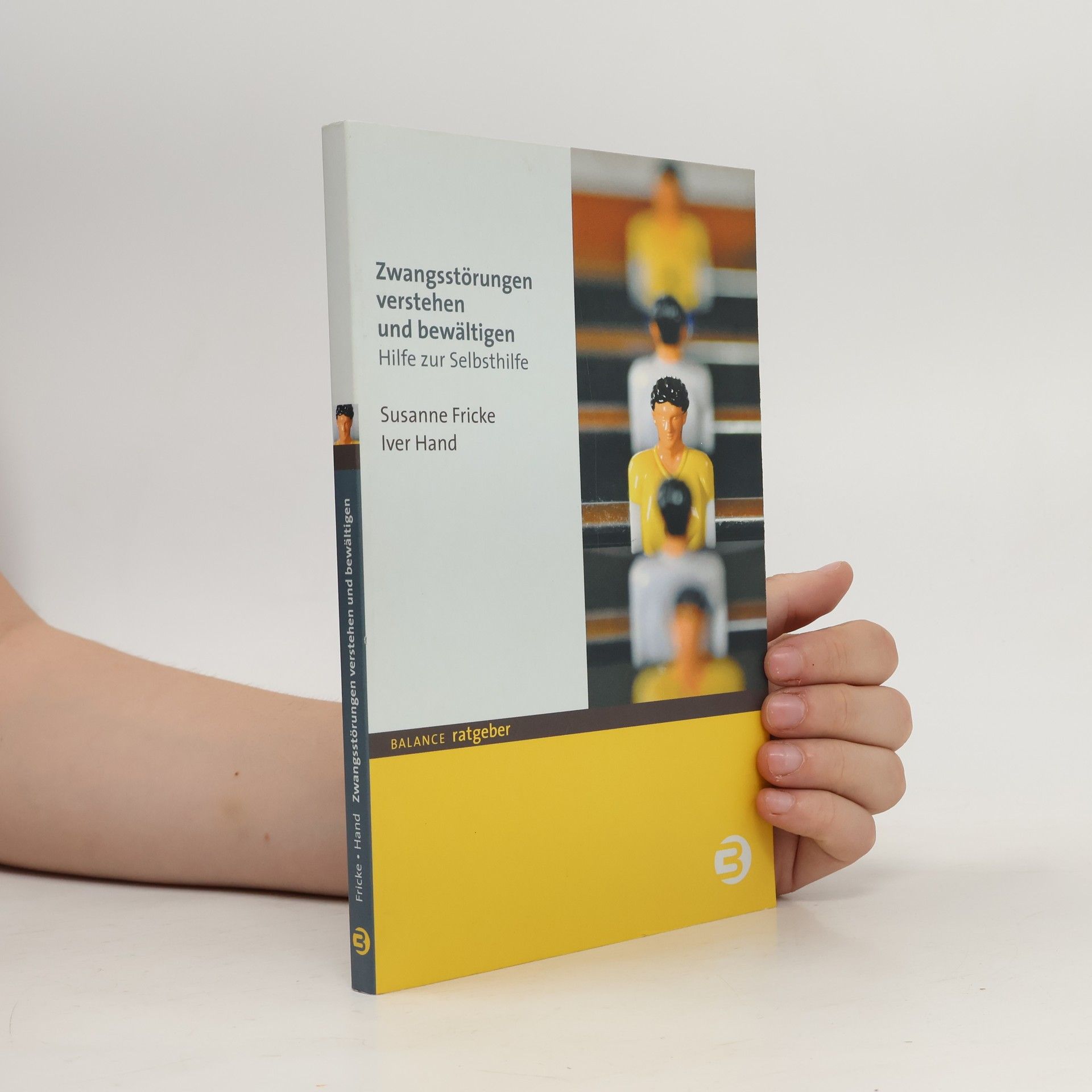
Dem Zwang die rote Karte zeigen
Ein Ratgeber für Kinder und Jugendliche und ihre Eltern
Dieses Buch hilft gegen Der erste altersgerechte Ratgeber für junge Menschen mit Zwangsstörungen unterstützt auch Eltern und Theuten beim Kampf gegen den Zwang. Zwei im Umgang mit Zwangserkrankungen erfahrene Psychotheutinnen informieren in unkomplizierter Sprache über die Merkmale und Therapiemöglichkeiten von Zwangsstörungen. Humorvoll, einfühlsam und mit zahlreichen konkreten Beispielen helfen die Autorinnen dabei, die Krankheit zu verstehen und zu bewältigen. Dieser Ratgeber holt die Betroffenen aus ihrer Einsamkeit und unterstützt sie dabei, Schritt für Schritt den Zwang zu vertreiben. Zusätzliche Informationen für die Eltern – die natürlich auch die Jugendlichen lesen dürfen – und Arbeitsmaterialien im Buch sowie als Download inklusive!
Zwangsstörungen verstehen und bewältigen
Hilfe zur Selbsthilfe
Dieser kompakte Ratgeber ermutigt dazu, den hartnäckigen Untermieter Zwang, der sich leicht zum Haustyrann entwickeln kann, wieder loszuwerden. Bewährte verhaltenstherapeutische Methoden werden verständlich und nachvollziehbar erklärt. Betroffene lernen, die Tricks ihres Zwangs zu durchschauen, erfahren, wodurch sie ihm neue Nahrung geben und welche Übungen ihnen helfen können, ihn zu bekämpfen. Wenn der Zwang trotz aller Selbsthilfe hartnäckig bleibt, bietet der Ratgeber hilfreiche Adressen und Tipps für professionelle Unterstützung und Behandlungsmöglichkeiten. Die Autoren beschreiben die Zwangsstörung, ihre Erscheinungsformen, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten auf leicht verständliche und manchmal amüsante Weise. Mithilfe von Arbeitsblättern im Buch können Betroffene feststellen, ob eine Zwangsstörung vorliegt, welche Risikofaktoren Zwänge fördern und welche Schutzfaktoren helfen, gegen den Zwang anzukämpfen. So können Zwangserkrankte in kleinen Schritten eine erfolgversprechende Therapie zusammenstellen. Auch für noch nicht zur Therapie entschlossene Betroffene ist der Ratgeber empfehlenswert, da er Lust auf ein Leben ohne Zwang macht. PD Dr. Susanne Fricke, Psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, hat sich seit vielen Jahren auf die Behandlung von Zwangserkrankungen spezialisiert und ist Autorin zahlreicher Bücher und Artikel zu diesem Thema.
Zwangsstörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Therapeuten zögern jedoch oft, Patienten mit dieser Diagnose in Behandlung zu nehmen – häufig besteht die Sorge, dass die Therapie kompliziert sei. Susanne Fricke macht deutlich, dass Zwänge durchaus gut behandelbar sind.
Menschen mit einer Zwangserkrankung bringen ihre therapeutischen Helfer nicht selten »auf die Palme«. Strapaziert wird nicht nur die Geduld im Umgang miteinander, sondern der Helfer ist immer wieder gefordert, seine eigenen Werte und Normen zu reflektieren und auch zu diskutieren. Deshalb hält sich hartnäckig die Ansicht, dass diese Erkrankung schwer zu behandeln sei. Dieses Basiswissen rückt, neben umfassenden Informationen über Zwangserkrankungen, auch die positiven Seiten dieser als schwierig geltenden Patientengruppe ins Blickfeld. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Aspekten, die für die praktische Arbeit mit Zwangserkrankten wichtig sind: motivieren, abgrenzen, stärken. Klar, systematisch und in komprimierter Form werden an vielen Beispielen Erscheinungsformen von Zwangserkrankungen geschildert und Wege gezeigt, wie man konstruktiv mit ihnen umgehen kann, ohne sich selbst nerven zu lassen.
Nicht jeder Zwangspatient ist gleich! Deswegen stellen die Autoren des Buchs 13 Kasuistiken vor, wie Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen in renommierten Kliniken umgesetzt wird. Die Therapeuten beschreiben dabei ihr Vorgehen Schritt-für-Schritt am Patientenbeispiel. Sie erläutern genau ihre Vorgehensweisen, weisen auf typische „Fallstricke“ in der Therapie hin und bieten Lösungsmöglichkeiten für Probleme an. Das Buch beantwortet häufig gestellte Fragen: Wie gehe ich in der Therapie mit komorbiden Patienten um? Wie kann ich mein Vorgehen variieren? Welche alternativen verhaltenstherapeutischen Möglichkeiten gibt es?