Die Produktivität der Antinomie
Hegels Dialektik im Lichte der genetischen Erkenntnistheorie und der formalen Logik
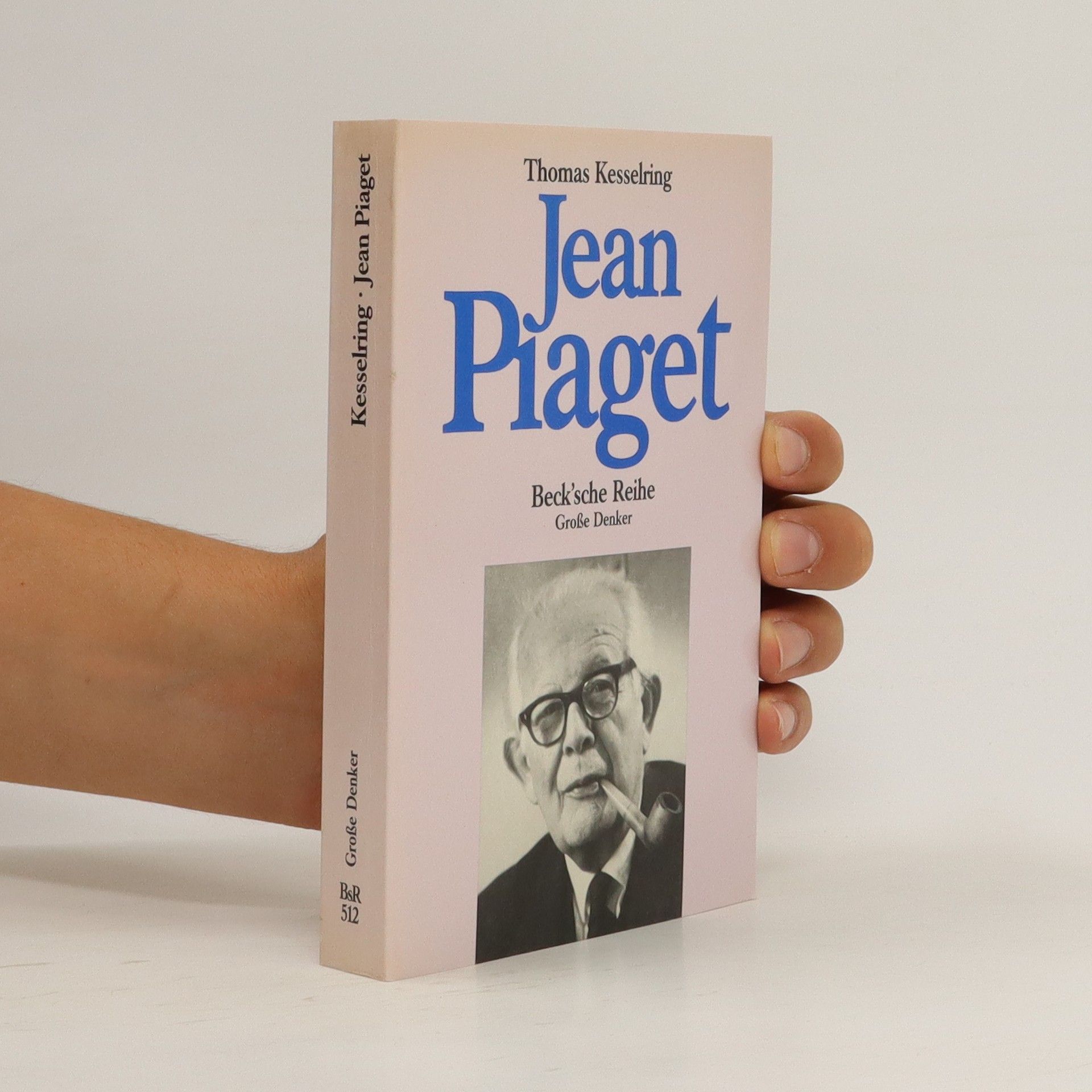
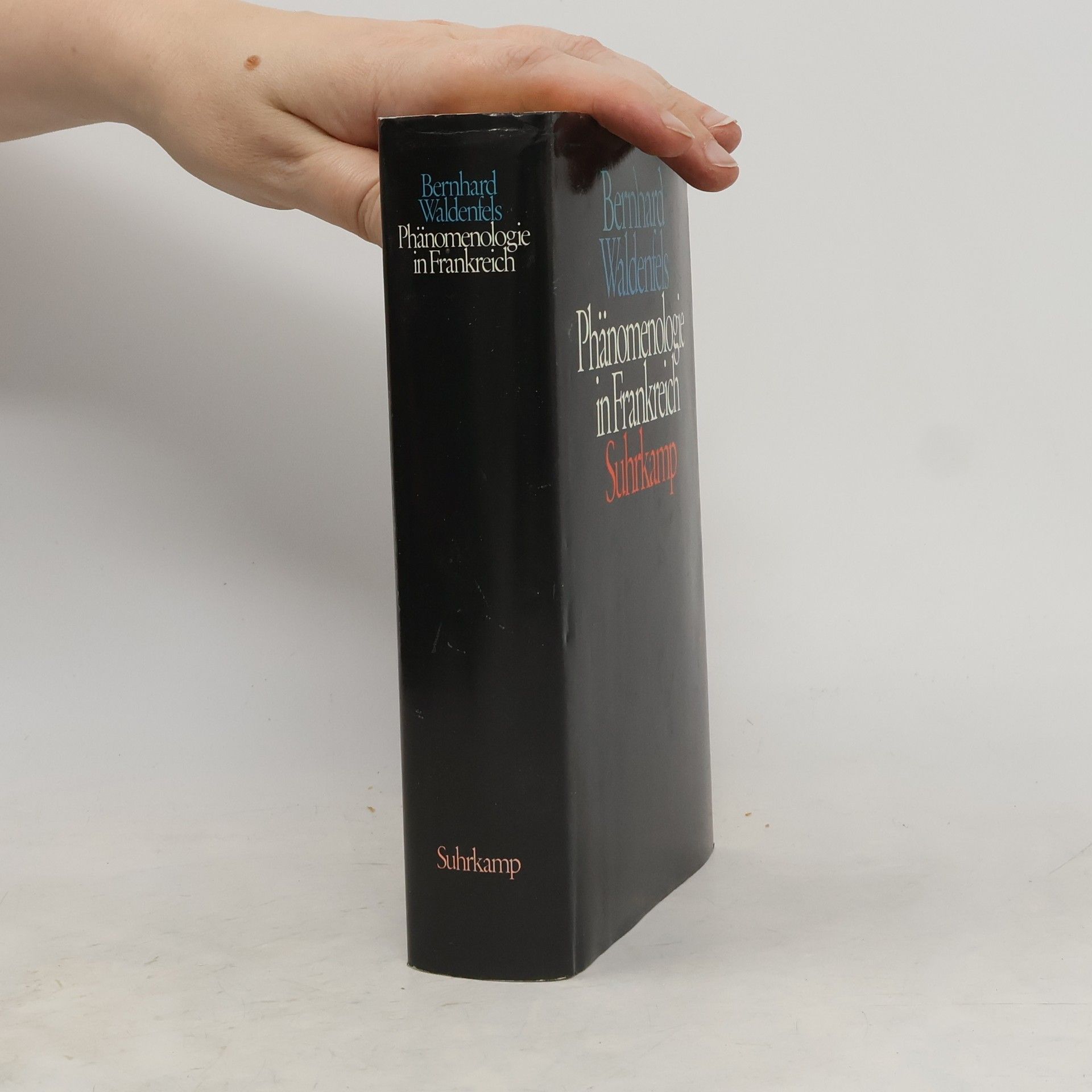



Hegels Dialektik im Lichte der genetischen Erkenntnistheorie und der formalen Logik
Thomas Kesselring untersucht im ersten Teil dieses Buches die philosophische Diskussion um Entwicklungshilfe und internationale Gerechtigkeit seit den sechziger Jahren. Im zweiten Teil analysiert er sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte der Globalisierungs-Euphorie der neunziger Jahre. Kesselring betont, dass Ethik mit der Fähigkeit zu tun hat, vom eigenen Standpunkt abzusehen, eine Fähigkeit, die in Zeiten der rasanten Globalisierung besonders wichtig ist. Die wachsende Kluft zwischen Entwicklungsländern und Industriestaaten sowie die fortwährende Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen machen deutlich, dass reiche Nationen nicht untätig bleiben können. Aus philosophischer Sicht entwickelt Kesselring eine Ethik der Entwicklungszusammenarbeit, die theoretisch fundiert ist und die praktische Analyse im Blick behält. Er erörtert verschiedene philosophische Theorien zu Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Kooperation, analysiert die Konzepte und Praktiken der Globalisierung, diskutiert die Vor- und Nachteile des Freihandels und beleuchtet die ökologische Dimension der internationalen Vernetzung. Daraus ergibt sich seine Vision, wie ernsthafte Entwicklungszusammenarbeit das Zusammenleben der Menschen und Völker gerechter und nachhaltiger gestalten kann. Handeln die reichen Nationen nicht jetzt, werden sie bald die Konsequenzen spüren – die Ausbreitung des internationalen Terrorismus könnte nur der Anfang sein.
Pädagogik und Ethik sind seit Jahrhunderten eng miteinander verbunden. Zum einen ist Ethik die Voraussetzung allen pädagogischen Handelns und begleitet dies auf Schritt und Tritt: Schülerinnen und Schüler sind unter Wahrung von Fairness- und Gerechtigkeitsgesichtspunkten zu fördern. So sollen Fähigkeiten aufgebaut werden, die nicht nur kurzfristig nützlich, sondern auch langfristig sinnvoll und in ethischer Hinsicht wünschenswert sind. Zum anderen sind pädagogische Prozesse eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung ethischer Anliegen. Die Erhaltung einer Gesellschaft, die ethische Minimalkriterien erfüllt – Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit, Sensibilität für die Erhaltung der Umwelt etc. –, setzt auf Seiten der Bürger ethische Kompetenzen voraus. Mit dem vorliegenden Band liefert Thomas Kesselring auf knappem Raum und klar strukturiert einen Führer durch die vielen Schnittstellen zwischen Ethik und schulischem Unterricht bzw. Ethik und Erziehung, Ethik und Bildung.
Mit seiner Arbeit verfolgt Th. Kesselring zwei Ziele: erstens eine philosophische Aufarbeitung der genetischen Psychologie Jean Piagets und der Parallelen, die zwischen dieser und einer der mächtigsten Traditionen der deutschen Philosophie bestehen: derjenigen des Idealismus im allgemeinen und Hegels im besonderen. Im Dienste dieses ersten Ziels leistet Kesselring zweitens einen Beitrag zu einer nationalen Rekonstruktion Hegelscher Dialektik. Dabei setzt er einerseits Hegel-immanent an - freilich ohne die Hegeische Terminologie unbefragt stehenzulassen -, und andererseits legt er ein Modell vor, worin das Prinzip der Hegeischen Dialektik auf die von Piaget und seinen Mitarbeitern erforschte kognitive Entwicklung übertragen wird. Dieses Programm dient nicht zuletzt dem Versuch, die Grundlagen der Hegeischen Philosophie in eine Hegel-externe Begrifflichkeit zu übersetzen - ein Unternehmen, das nebenbei auch Erwägungen zur Bedeutungstheorie und zu Fragen aus dem Bereich der Philosophie der Logik erforderlich macht.
German