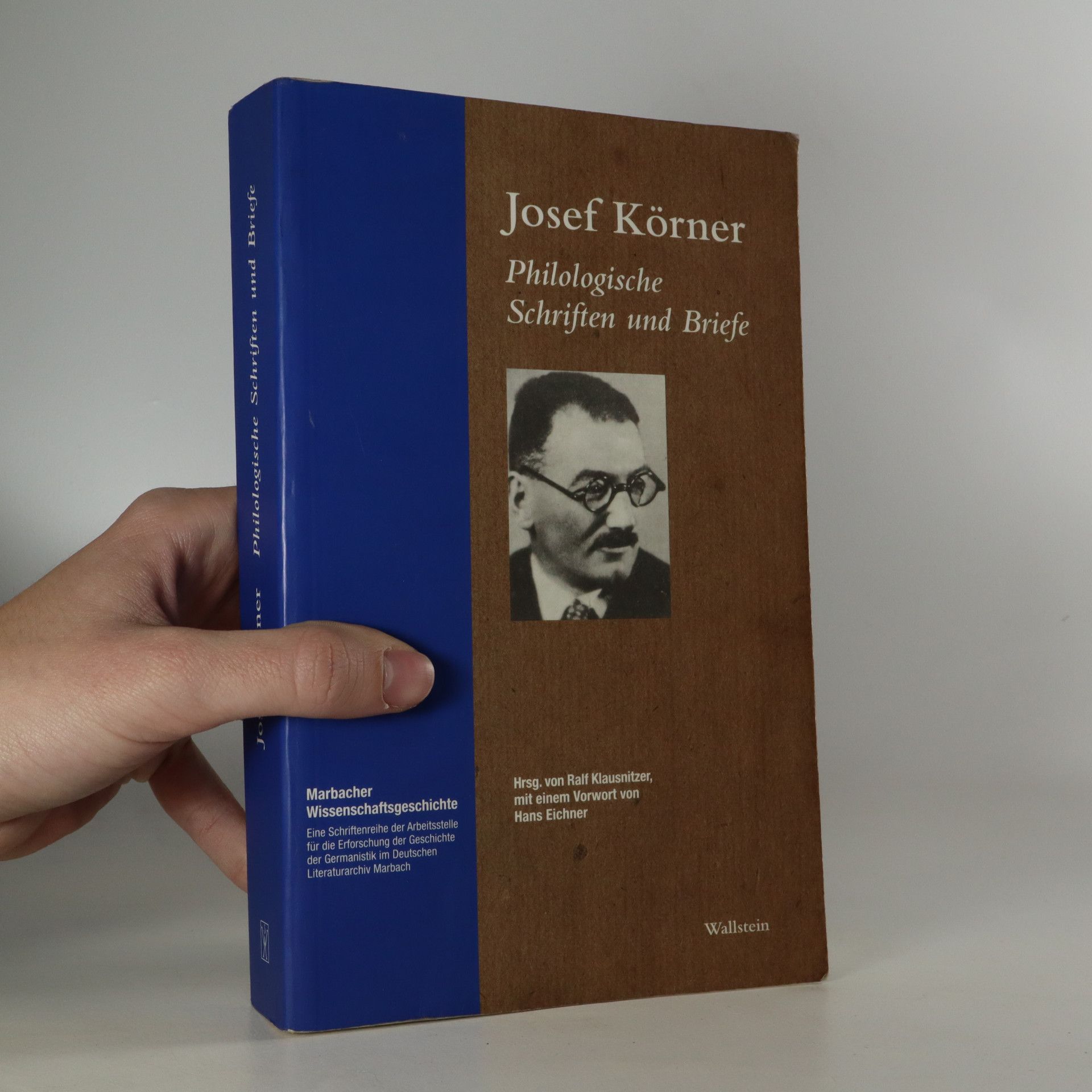Literaturwissenschaft
- 240pages
- 9 heures de lecture
Diese Einführung richtet sich an Studierende im germanistischen Grundstudium. Sie vermittelt die zentralen Konzepte und Methoden der Literaturwissenschaft und zugleich die wichtigsten Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. Ausgewählte Beispiele aus Lyrik, Prosa und Dramatik eines Autors bilden die Grundlage, um Fragen der sachgerechten Interpretation und historischen Einordnung von fiktionalen Texten zu erörtern, z. B.: Was ist ein literarischer Text und was heißt es, ihn zu lesen, zu verstehen und zu interpretieren? Wie lassen sich literarische Gattungen bestimmen? Was ist ein Autor? Wie lässt sich ein Werk einer literaturgeschichtlichen Epoche zuordnen? Welche Beziehungen bestehen zwischen Literatursystem, Medien und Gesellschaft? Als eine systematisch aufgebaute und in der Praxis erprobte Einführung vereint dieses Studienbuch die Vorzüge einer homogenen Erläuterung grundlegender Konzepte und Termini mit konkreten Beispielanalysen.