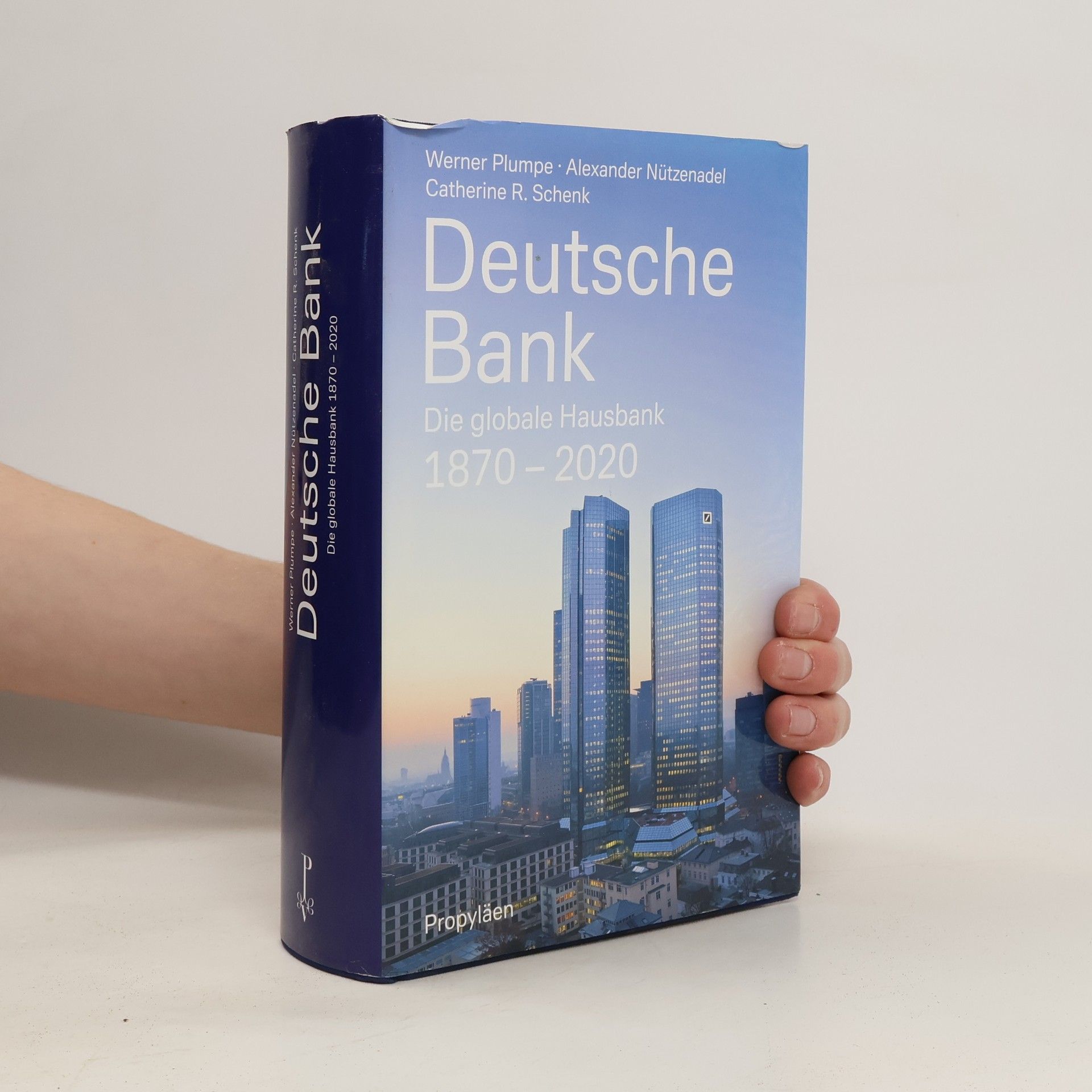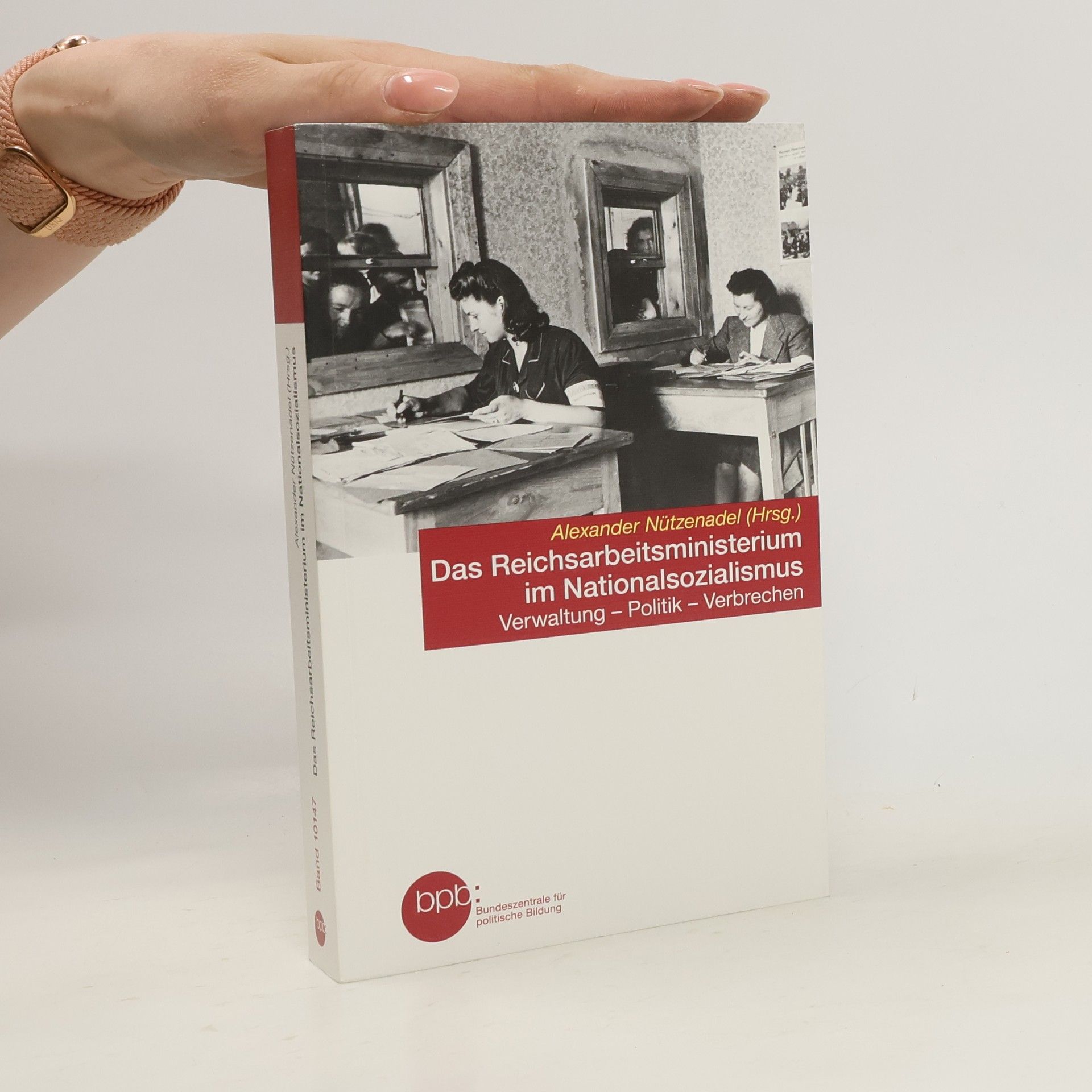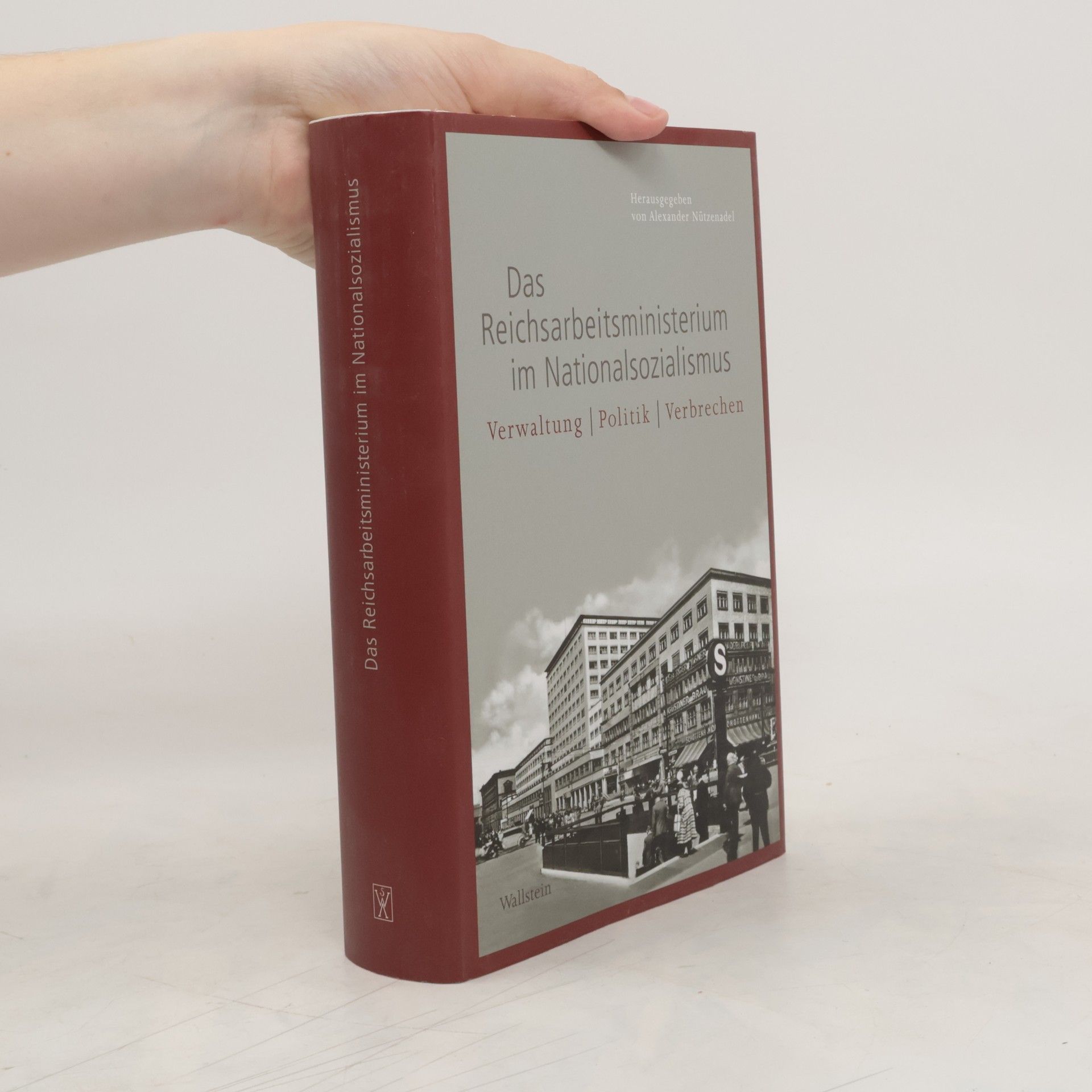Das Reichsarbeitsministerium im Nationalsozialismus
Verwaltung – Politik – Verbrechen
Ein herausragender Beitrag zur Erforschung von Bürokratie und Gewaltherrschaft im »Dritten Reich«. Die Arbeits- und Sozialpolitik spielte für das ideologische Selbstverständnis der NSDAP als Arbeiterpartei eine zentrale Rolle. Welche Stellung das Reichsarbeitsministerium im Kontext der NS-Herrschaft einnahm, wird seit 2013 im Rahmen eines Forschungsprojekts des Bundesarbeitsministeriums von einer unabhängigen Historikerkommission untersucht. Im ersten Band der Veröffentlichungen der Kommission werden die Forschungsergebnisse umfassend präsentiert. In den Blick genommen werden neben Behördenstruktur und Personal die Handlungsfelder des Ministeriums, die von der Arbeitsmarkt- und Tarifpolitik über das Sozialversicherungswesen bis zur Wohnungsbau- und Siedlungspolitik reichten. Zugleich wird die Rolle des Ministeriums im Rahmen der Kriegswirtschaft und in den besetzten Gebieten Europas zwischen 1939 und 1945 beleuchtet. Deutlich wird, dass die klassischen Verwaltungsapparate weitaus stärker in das NS-Regime und seine Verbrechen eingebunden waren als lange Zeit vermutet wurde. Die ministerielle Bürokratie kooperierte sogar eng mit den nationalsozialistischen Partei- und Sonderstäben. Damit werden bisherige Erklärungsmodelle, wie das einer »polykratischen« Herrschaft, in Frage gestellt.