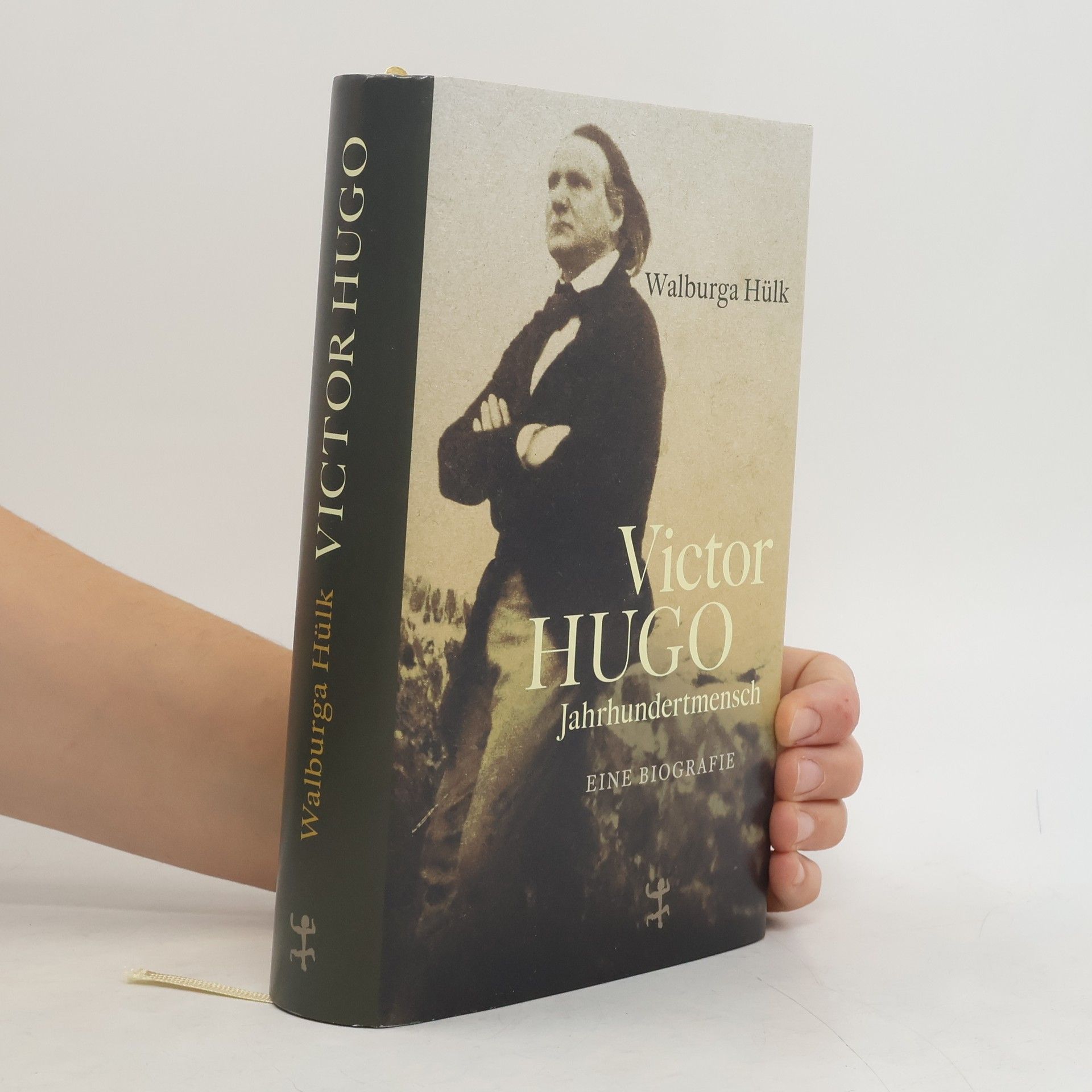Der Rausch der Jahre
Als Paris die Moderne erfand
Der Anbruch der Moderne - das Second Empire Napoleons III. zwischen Glanz und Abgrund Paris, 2. Dezember 1851: Louis Napoleon, Neffe des großen Napoleon Bonaparte, putscht sich an die Macht. Mit ihm wird Frankreich zum Zentrum der Welt. Es ist die Zeit der Gegensätze: Dekadenz und Reichtum auf der einen Seite, Unterdrückung und unmenschliche Arbeitsverhältnisse auf der anderen. Inmitten dieser turbulenten Zeiten kämpfen die Brüder Goncourt mit der Zensur, Victor Hugo muss das Land verlassen, Flaubert treibt sich im Bordell herum und Baudelaire raucht Haschisch. George Sand macht sich Sorgen um das Klima. Neben wegweisender Kunst und Literatur der Moderne entstehen im Zweiten Kaiserreich auch ein gigantisches Eisenbahnnetz, Frachthäfen, Fabriken und Bergwerke, Boulevardpresse und Spekulationsblasen. Haussmann walzt das verwinkelte Paris nieder und durchzieht die Stadt mit großen Boulevards. Der Krimkrieg ist der erste nach modernen Maßstäben geführte Krieg, der Suezkanal verändert den Welthandel nachhaltig. Kurz: Alles ändert sich rasend schnell. Bis Napoleon III. sich 1870 von der »Emser Depesche« provozieren lässt ... »Ein umwerfend temperamentvolles Epochenporträt. Ein ganz herausragendes Sachbuch.« Deutschlandfunk Kultur