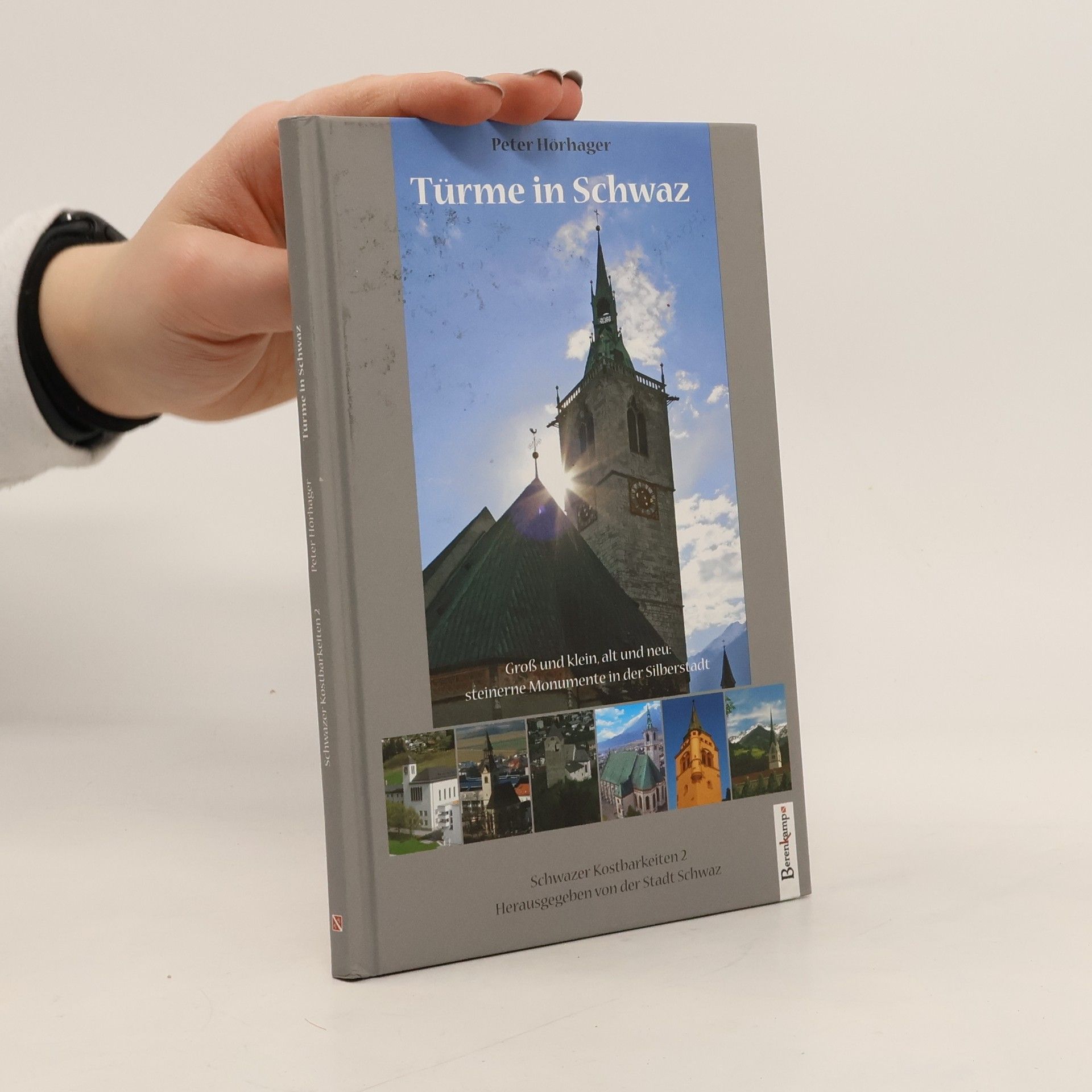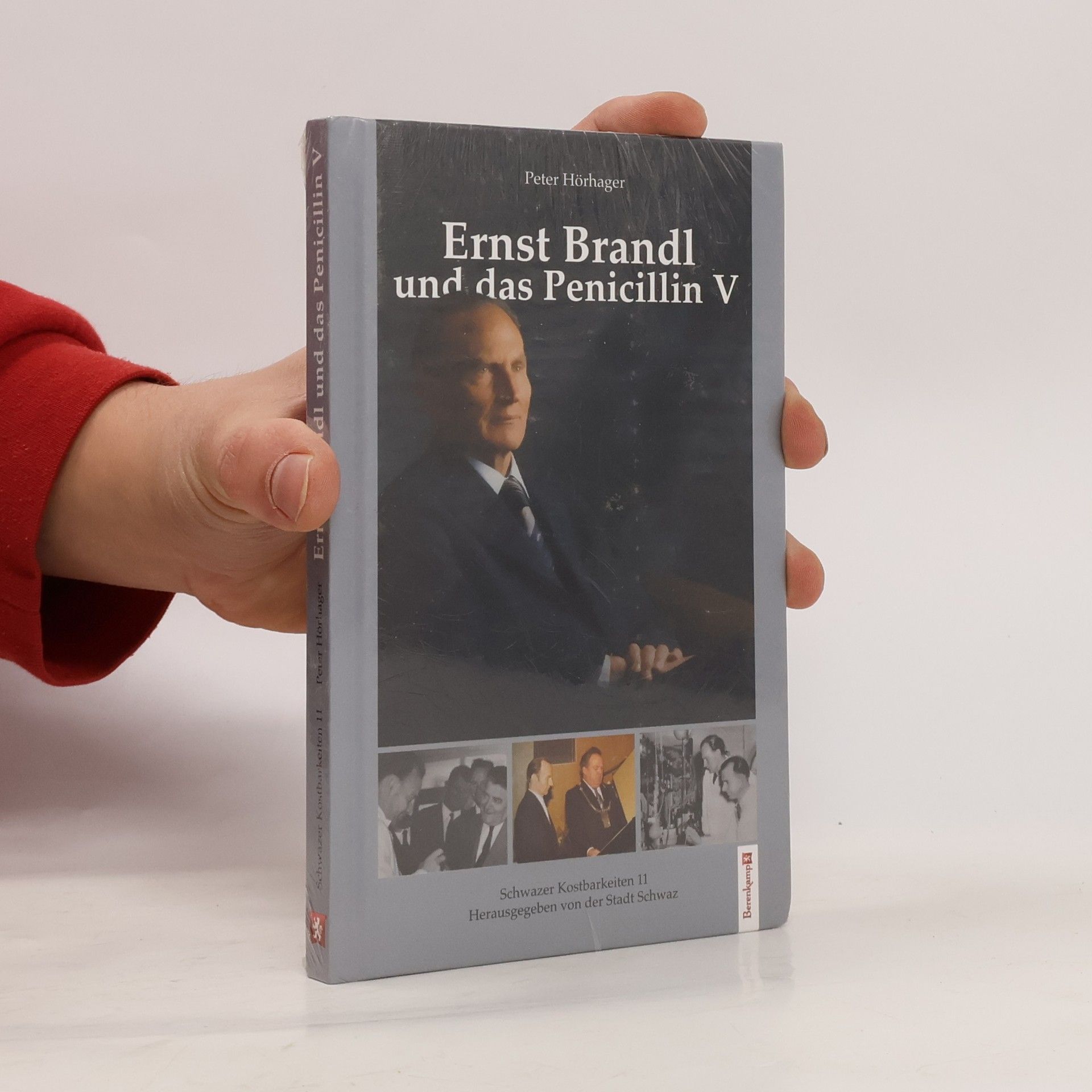Ernst Brandl und das Penicillin V
Schwazer Kostbarkeiten 11
Es war – wie in jedem Lehrbuch nachzulesen ist – Dr. Alexander Fleming, der das Penicillin entdeckte. Durch Zufall. Bei Studien in seinem Laboratorium in London bemerkte er, dass eine seiner Bakterienkulturen „verdorben“ beziehungsweise teilweise mit blaugrünem Schimmel bedeckt war. Dabei stellte er fest, dass sich die von ihm angesetzten Staphylokokken- Kolonien in einem beträchtlichen Umkreis um den Schimmelwuchs zersetzt hatten. Das war im Jahre 1928. Wie Fleming bei weiteren Versuchen entdeckte, hatte die Substanz, die er Penicillin nannte, eine fast unglaubliche Wirkung: Sie verhinderte die Ausbreitung vieler tödlicher Keime. 24 Jahre später schlug die Stunde von Dr. Ernst Brandl. Der Schwazer unterrichtete am 7. Jänner 1952 die Geschäftsleitung der Biochemie Kundl von seiner Entdeckung des säurestabilen Penicillins. Damit war erstmals ein Weg gefunden, den Wirkstoff auch als Tablette oder Sirup zu verabreichen. Am 10. Februar desselben Jahres gelang Brandls Freund und Studienkollegen Dr. Hans Margreiter die Isolierung der Penicillin V-Säure. Am 22. April 1952 wurden die neue Substanz und ihr Herstellverfahren in Österreich zum Patent angemeldet. Dank der Entdeckung der zwei Tiroler entwickelte sich die Biochemie Kundl zu einem Pharmaunternehmen von Weltgeltung. Sein Vermögen brachte Ernst Brandl, der auch ein feinsinniger Poet war, in eine Stiftung ein.