Herbert Marcuses "Der eindimensionale Mensch" wird als Schlüsselwerk für die Studentenbewegung der 68er Generation beschrieben, das 1964 in den USA erschien. Inmitten des Kalten Krieges analysiert Marcuse die Gefahren einer konsumorientierten Gesellschaft, die ein falsches Bewusstsein schafft und wichtige gesellschaftliche Zusammenhänge verschleiert. Die Studienarbeit bietet eine hermeneutisch-interpretative Betrachtung des ersten Kapitels und beleuchtet zugleich biographische sowie ideengeschichtliche Einflüsse, die für das Verständnis des Werkes von Bedeutung sind.
Juliane Scholz Livres
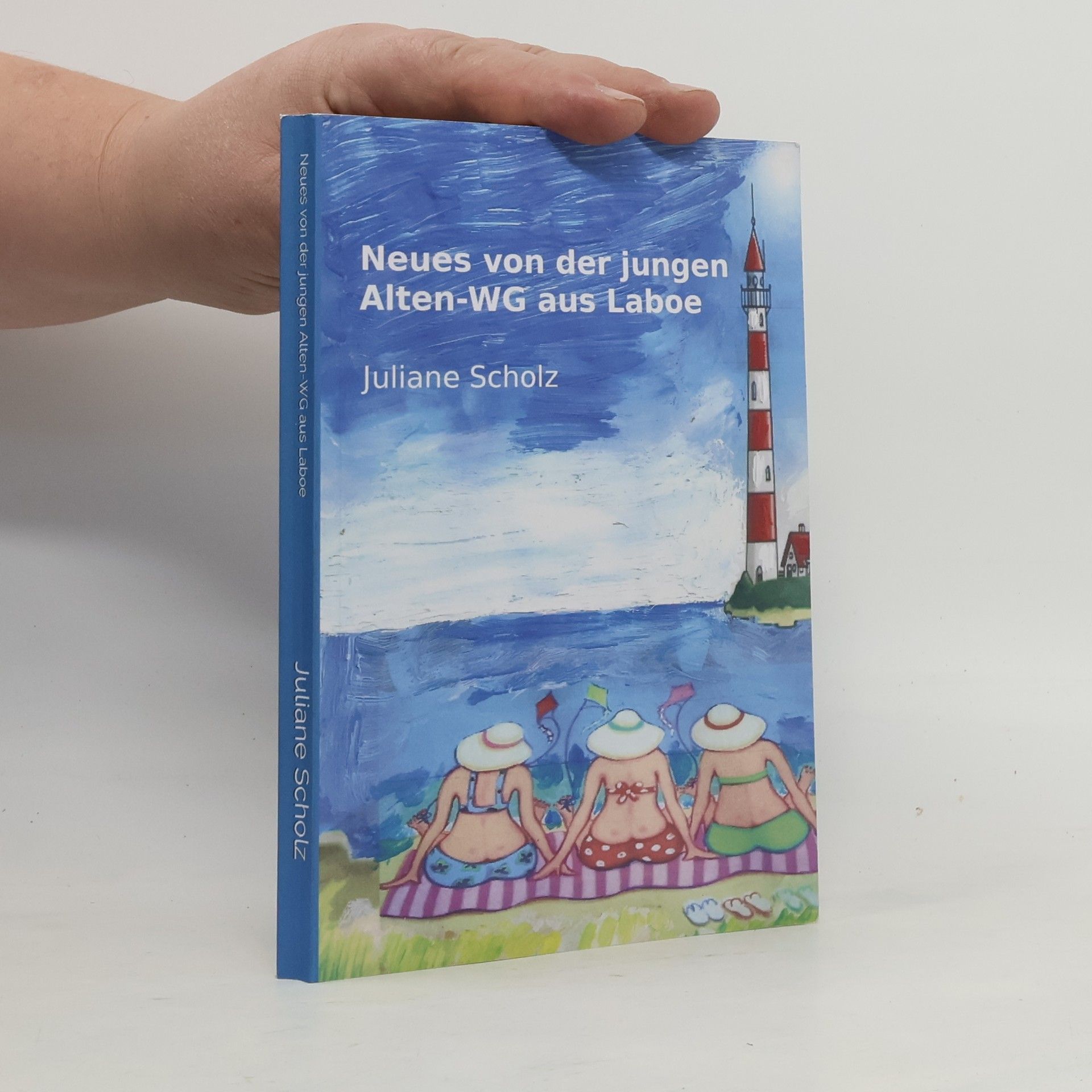
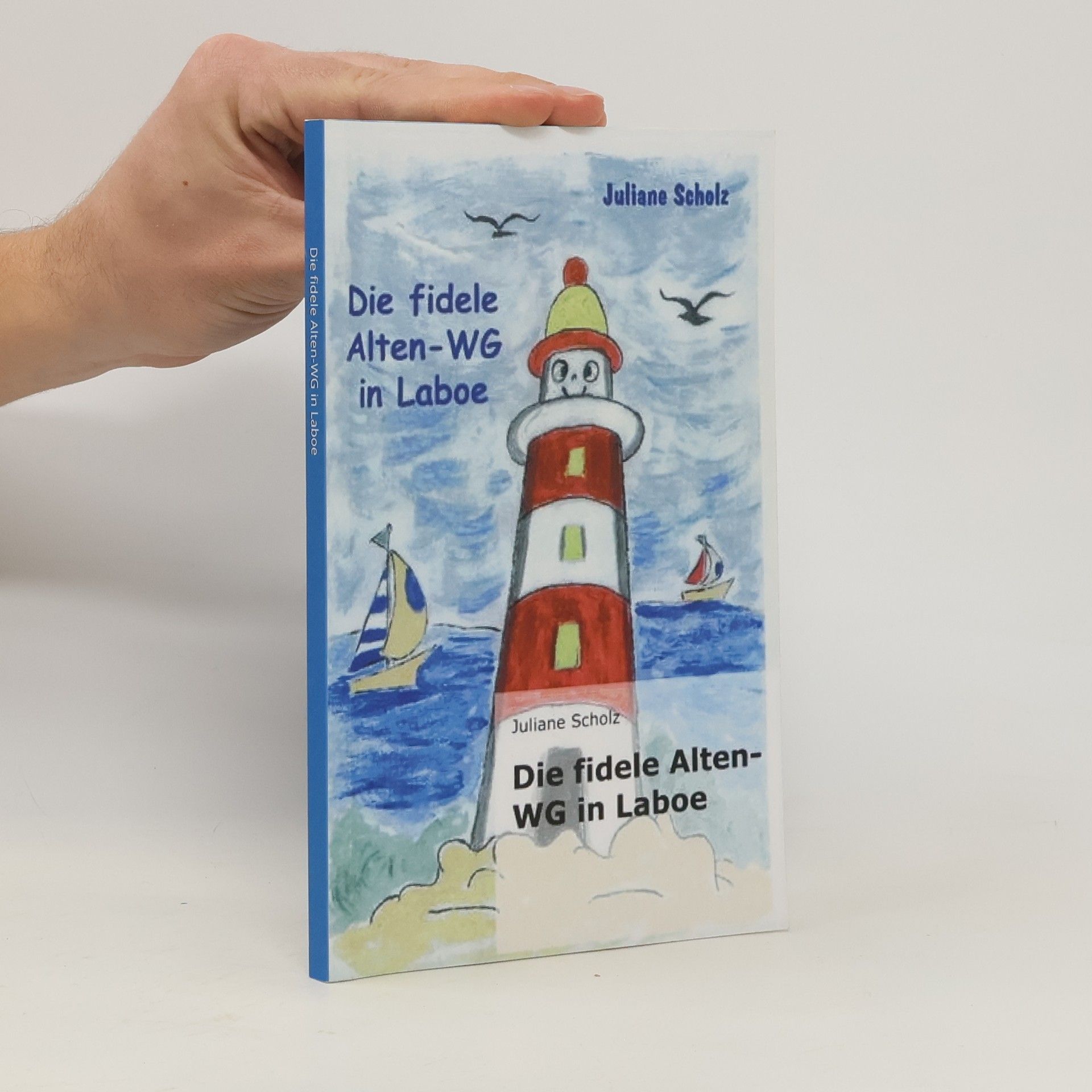



Sozialgeschichte der Max-Planck-Gesellschaft
Personalentwicklung, Karrieren und Arbeitsbedingungen 1948-2005
- 584pages
- 21 heures de lecture
Die Analyse beleuchtet die Entwicklung des Personals in der Max-Planck-Gesellschaft und untersucht die spezifischen Merkmale der verschiedenen Berufsgruppen. Juliane Scholz thematisiert die Konflikte des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie die Herausforderungen durch die Befristungspolitik und die Rekrutierung von Spitzenforscher:innen. Zudem werden Forderungen nach Mitbestimmung und die Demokratisierung der Hierarchien behandelt. Der Erfolg der Institution wird als Ergebnis kollektiver Anstrengungen und arbeitsteiliger Kooperationen dargestellt, nicht nur durch die Leistungen einzelner Forscher:innen.
Mehr Partizipation - weniger Legitimation?
- 400pages
- 14 heures de lecture
Das Buch untersucht die Beziehung zwischen Partizipation und Legitimation in der EU. Die Autorin identifiziert strukturelle Probleme der Beteiligungsformen und zeigt anhand einer Typologie sowie zwei Fallstudien, dass mehr Partizipation nicht zwangsläufig die demokratische Legitimation stärkt. Es bietet wertvolle Einsichten für Wissenschaft und Politik.
Die fidele Alten-WG in Laboe
- 131pages
- 5 heures de lecture
Wir sind eine 8 Freunde-WG - leben an der Ostsee - haben nicht viel Rente - leisten uns trotzdem eine Haushälterin - und ganz wichtig, damit wir uns nicht ständig auf den Keks gehen, mit eigener Wohneinheit. Wie alles anfing und wie wir ticken wird hier sehr humorvoll beschrieben.
Ostsee-WG mit alten Freunden: Neues von der jungen Alten-WG aus Laboe
- 186pages
- 7 heures de lecture
Wir sind eine 8 Freunde-WG - leben an der Ostsee - haben nicht viel Rente - leisten uns trotzdem eine Haushälterin - und ganz wichtig, damit wir uns nicht ständig auf den Keks gehen, mit eigener Wohneinheit.In diesem Buch finden sich weitere Anekdoten aus unserem Dies ist der zweite Teil des Buches "Die fidele Alten-WG in Laboe".