Hans Herman Hartwich Livres
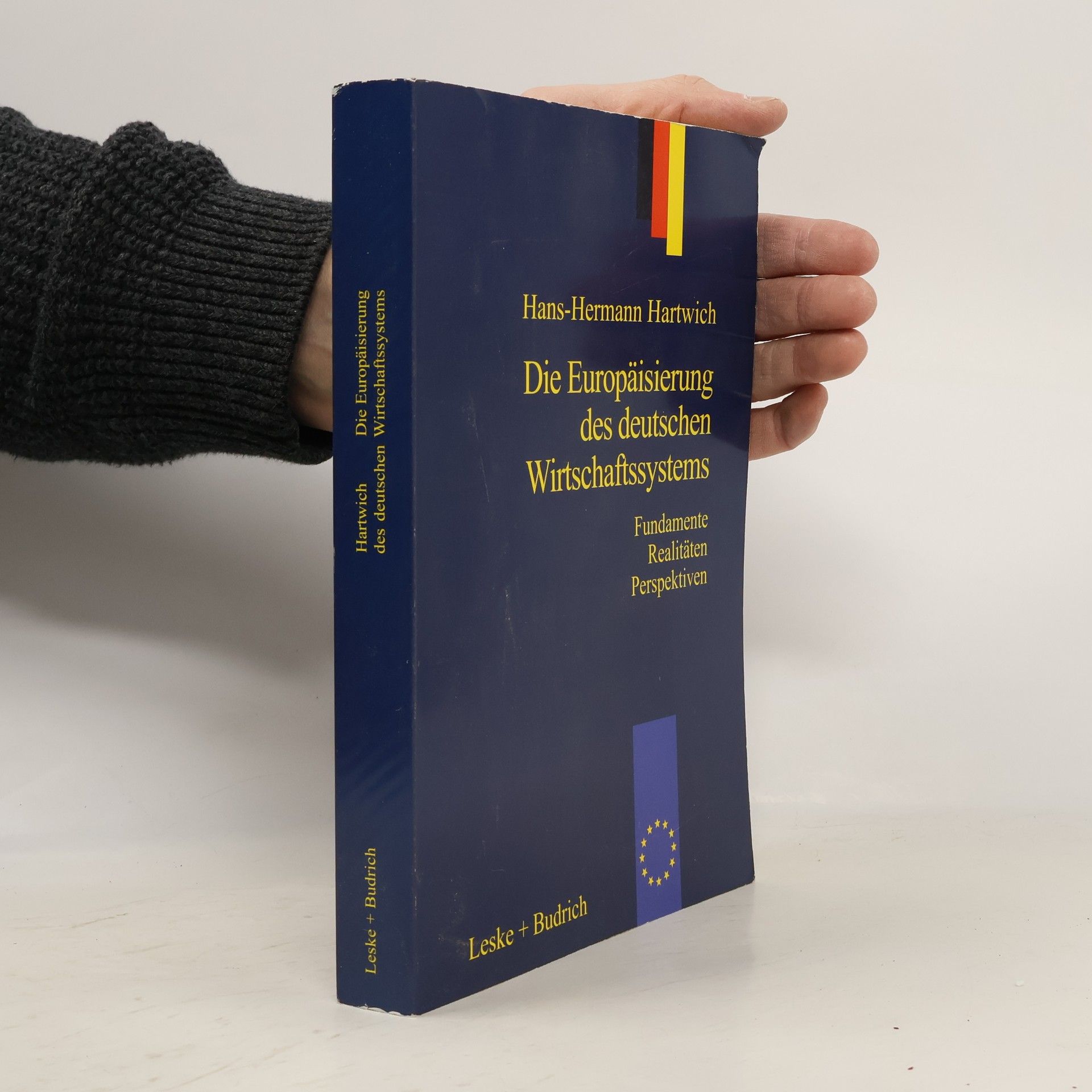
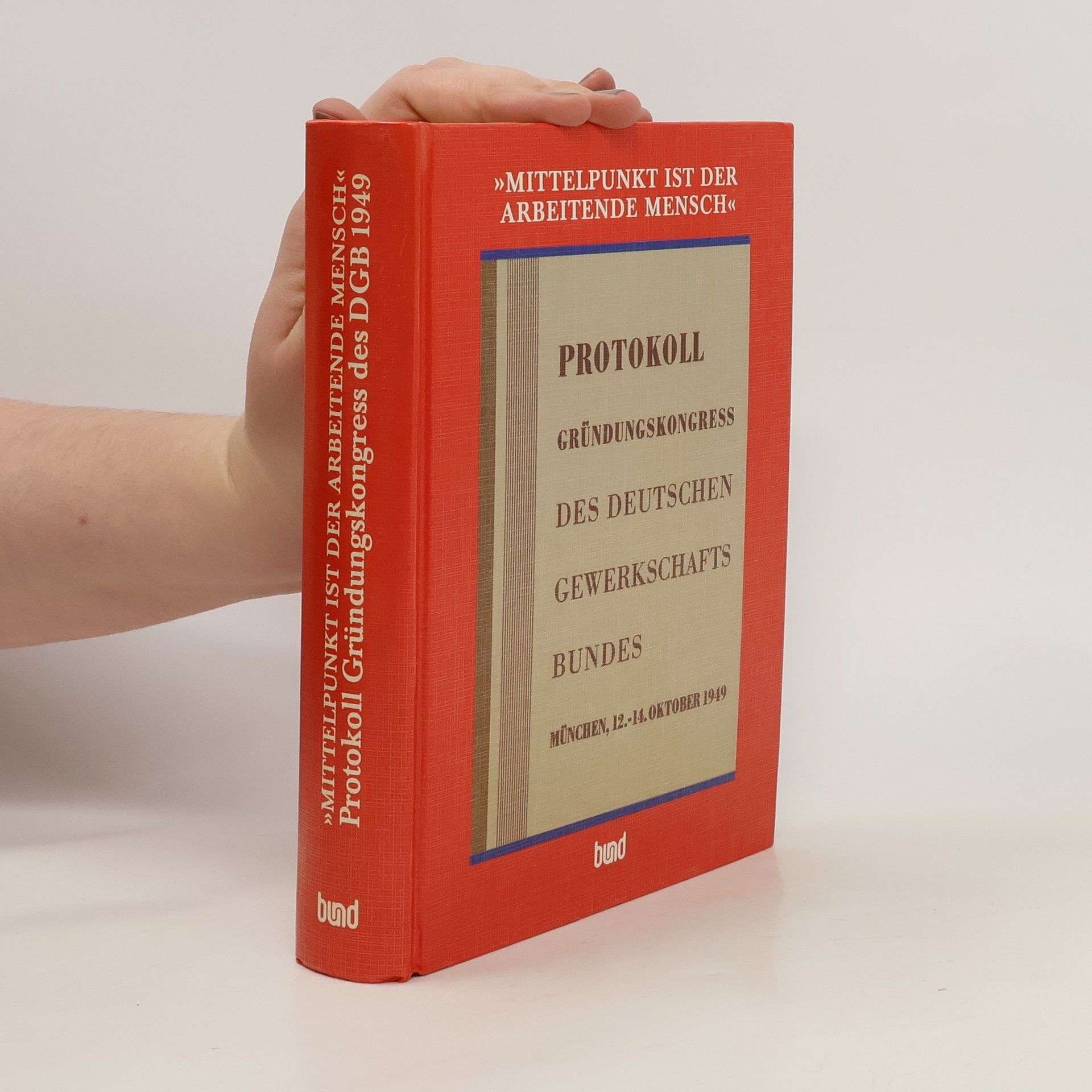

Die Europäisierung des deutschen Wirtschaftssystems
Alte Fundamente neue Realitäten Zukunftsperspektiven
- 368pages
- 13 heures de lecture
Die Suche nach einem realitätsnahen Verständnis von Wirtschaft und Politik prägt dieses Buch. Die Flut an täglichen Informationen steht in starkem Kontrast zum Wissen um Zusammenhänge, was zu einem Defizit an ganzheitlicher Sicht führt. Die Kluft zwischen medialer Welt und subjektiver Lebenswahrnehmung ist besorgniserregend, da Medien für die Identität der Bürger in der modernen Wirtschaftsgesellschaft unverzichtbar geworden sind. Diese Identität erfordert nicht nur eine Vielzahl von Informationen, sondern auch ein Verständnis von vertikalen Zusammenhängen in Geschichte, Gegenwart und Zukunft sowie von horizontalen, intelligenten Überschreitungen spezialisierter Wissensbereiche. Antworten auf die Diskrepanzen unserer Wirklichkeitswahrnehmung werden hier gesucht, die oft durch hochspezialisierte Fachwissenschaften verstärkt werden. Besonders wirtschaftswissenschaftliche Experten liefern objektiv „richtige“ Analysen und Prognosen, die jedoch aufgrund der Komplexität der Lebensrealität problematisch sein können. Das „falsch“ und „richtig“ wird nicht sozialethisch verstanden, sondern zeigt, dass Fachexpertisen oft nicht zu Ende gedacht werden. Aktuell wird die Anpassung nationaler Volkswirtschaften an globale Wettbewerbsbedingungen intensiv diskutiert, wobei die Notwendigkeit „einschneidender“ Maßnahmen zur Wettbewerbsverbesserung und Standortsicherung als richtig erachtet werden kann.