Endlich erfahren auch bayerische Kinder, was mit ihnen passiert, wenn sie älteren Damen das Essen klauen, in Privathäuser und Gewerberäume einbrechen oder ihre Lehrer in die Luft jagen. „Max und Moritz af Bairisch“ erzählt Wilhelm Buschs genialen „Ur-Comic“ von 1865 urkomisch im Dialekt nach. Der Leser kann sich auf „siem schtoake Schtickl“ freuen, die das Original nicht wörtlich übersetzen, sondern reichlich mit bayerischem Humor garnieren. Eine Liebeserklärung an den Dialekt, an den unerschöpflichen bayerischen Sprachschatz und an Wilhelm Busch sowieso. Vor allem aber ein großer Lesespaß, oder sagen wir lieber „mords a Gaude“ für alle, die Sprache als ein Stück Heimat begreifen.
Klaus Schwarzfischer Livres
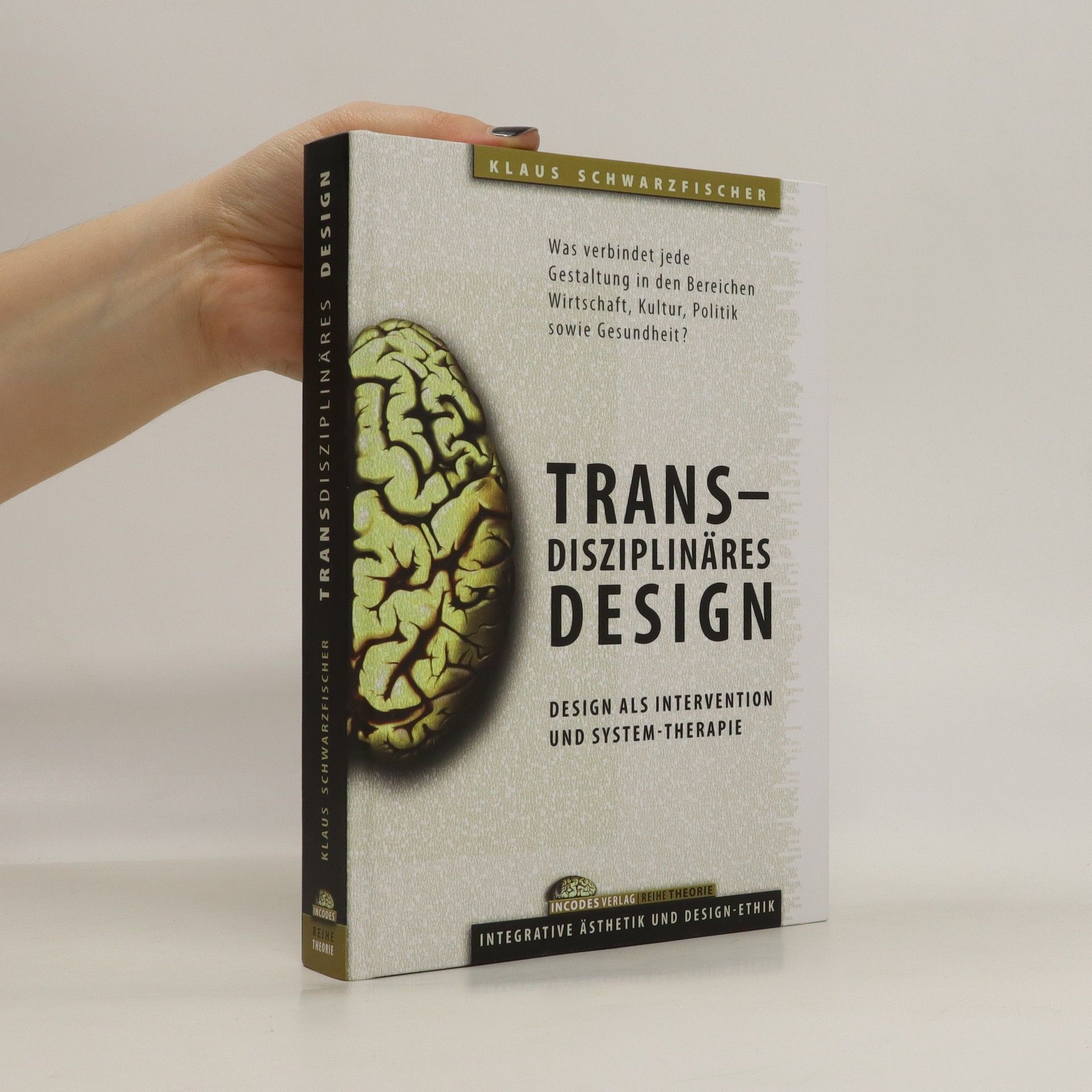
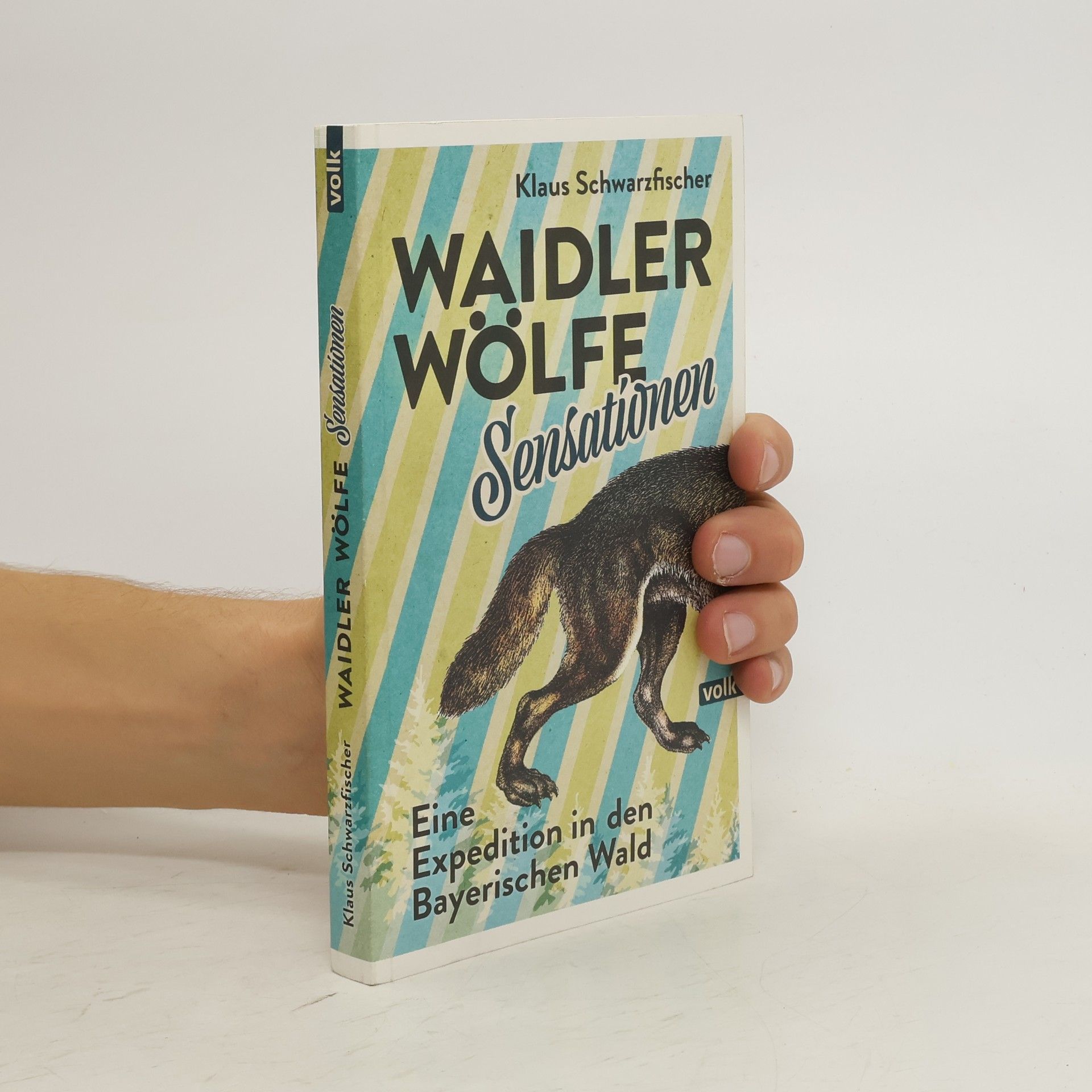

Waidler, Wölfe, Sensationen
Eine Expedition in den Bayerischen Wald
Begleiten Sie Klaus Schwarzfischer auf seinem Trip in eine der exotischsten Regionen der Nordhalbkugel: den Bayerischen Wald! Die literarische Forschungsreise spürt dem Wesen der Eingeborenen nach, erkundet deren Lebensraum, Sprache, Selbstverständnis, Paarungsverhalten und den Ursprung ihres gestörten Verhältnisses zu schlecht eingeschenktem Bier. Sonst noch dabei: skurrile Geschichten, Fakten, Mythen und herzzerreißende Oden an die Heimat. Grenzpolizist, Filmemacherin, Brettlspieler: Einheimische plaudern aus dem Nähkästchen. Trenk der Pandur trifft auf den Mühlhiasl, der Lusen auf Reinhold Messner, Freyung-for-Future auf den bösen Wolf. Der Autor selbst kommt aus der „Rammelkammer des Borkenkäfers“, wie der Bayerische Wald von Koleopterologen liebevoll genannt wird. Er weiß, wovon er schreibt, sei es die örtliche Sagenwelt, Sehenswürdigkeiten oder sensationelle Waidler-Entdeckungen. Sein Sammelsurium amüsanter und eigenwilliger Texte verschmilzt dabei zu einem formidablen Charaktergemälde des Bayerischen Waldes.
In der Diskussion über Kunst und Design wird häufig ein Selbstverständnis der Designer als Künstler betont, begleitet von der Klage über kommerzielle Einflüsse und Missverständnisse. Diese Argumentation bleibt jedoch oft unreflektiert, da die Begriffe „Kunst“ und „Design“ selten definiert werden. Stattdessen wird eine binäre Unterscheidung zwischen „Kunst“ und „Nicht-Kunst“ aufrechterhalten, die verschiedenen Interessengruppen wie Künstlern, Kunsthistorikern und Händlern Vorteile in Form von Geld, Status und sozialen Kontakten verschafft. Diese Exklusionsrhetorik dient der Schaffung von Eliten und wird nicht hinterfragt, da das Infragestellen der Begriffe als unangemessen gilt. Kunst wird oft als etwas Transzendentales betrachtet, das nicht verbal erklärt werden kann, was an schamanistische Praktiken erinnert. Historisch betrachtet zeigt sich, dass diese exklusive Sichtweise in Zeiten entstand, als die Aufklärung begann, die Religion zu hinterfragen. Der Begriff „Kunst“ hat sich über die Jahrhunderte gewandelt und sollte nicht als unveränderlich angesehen werden. Die Entwicklung von Kunst hin zu einem sozialen System, das Kommunikation thematisiert, führt zu einer neuen Perspektive: Kunst als Prozess der Wahrnehmung, der nicht an spezifische Artefakte gebunden ist. Letztlich ist es notwendig, von binären Unterscheidungen abzukommen und graduelle Unterschiede zu betrachten, um die Komplexität von Kunst und Design zu verstehen