Stefan Schieren Livres

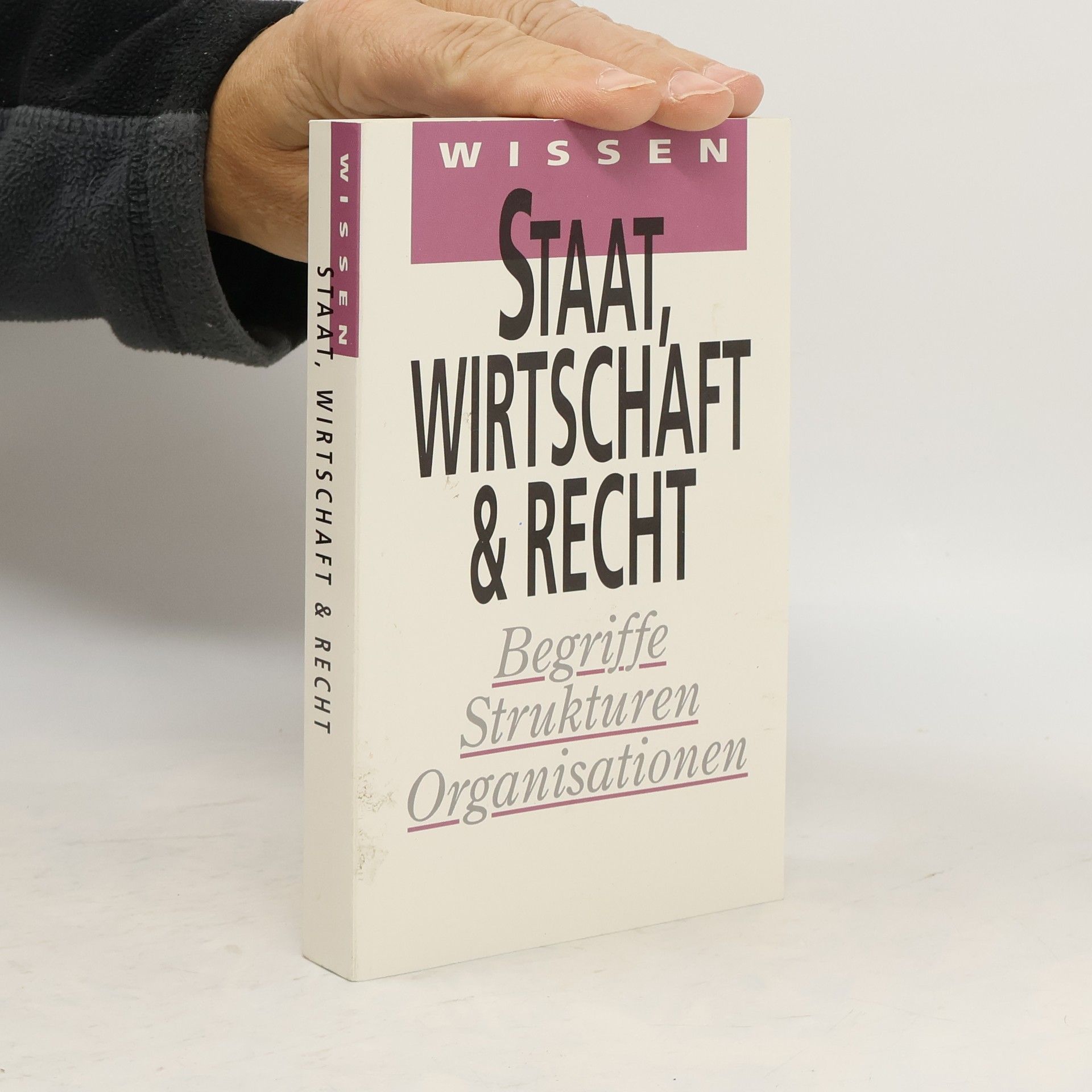
Der Brexit hat das politische System des Vereinigten Königreichs in eine Krise gestürzt, die auf den EG-Beitritt und die Politik der Thatcher-Regierung zurückzuführen ist. Unkoordinierte Verfassungsreformen haben die institutionelle Balance gefährdet. Die überarbeitete Neuauflage analysiert diese Entwicklungen im britischen politischen System.