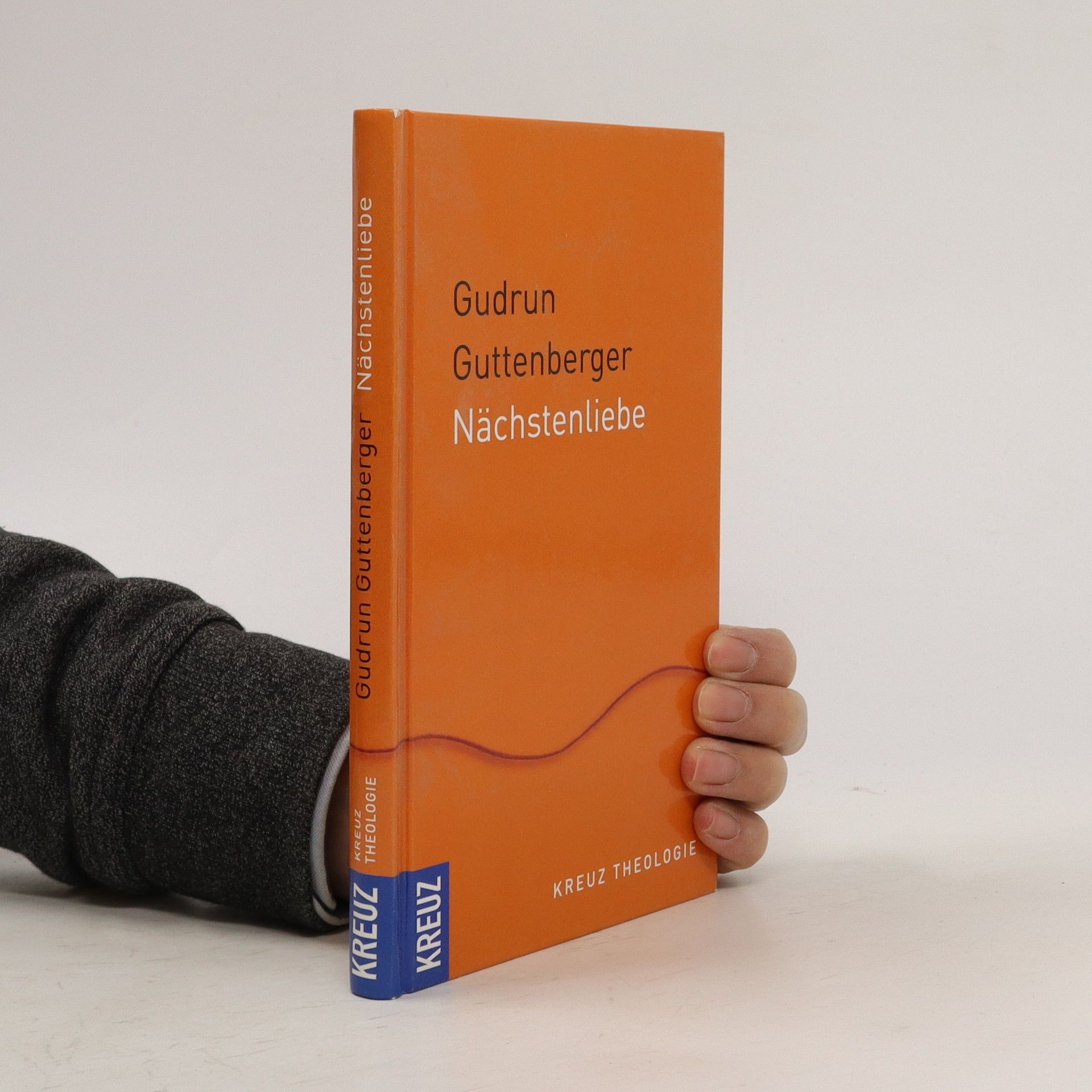Auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot antwortet Jesus den Pharisäern mit den Worten aus Matthäus 22, 37-40: „Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben (…)“ und „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Die Synthese dieser beiden Verse ist als das „Doppelgebot der Liebe“ zum Terminus technicus in der Theologie geworden und bringt in unübertroffener Prägnanz den Kern der christlichen Botschaft zum Ausdruck. Doch ist die Theorie das Eine, die Herausforderungen unseres heutigen Lebens das Andere. Die Rede von der Nächstenliebe birgt eine Fülle von Fragen – dieser neue Band der Reihe Kreuz Theologie versucht, darauf Antwort zu geben.
Gudrun Guttenberger Livres