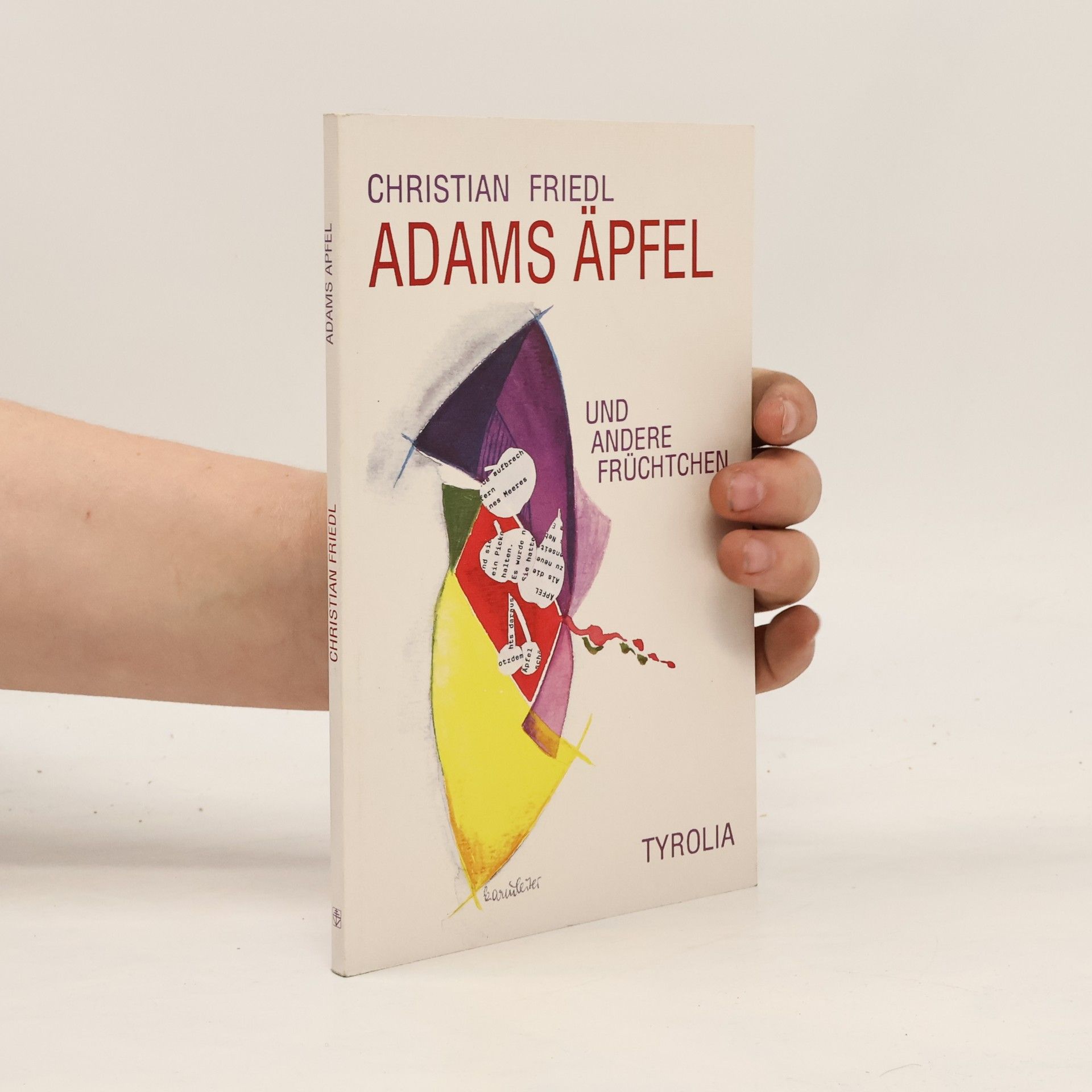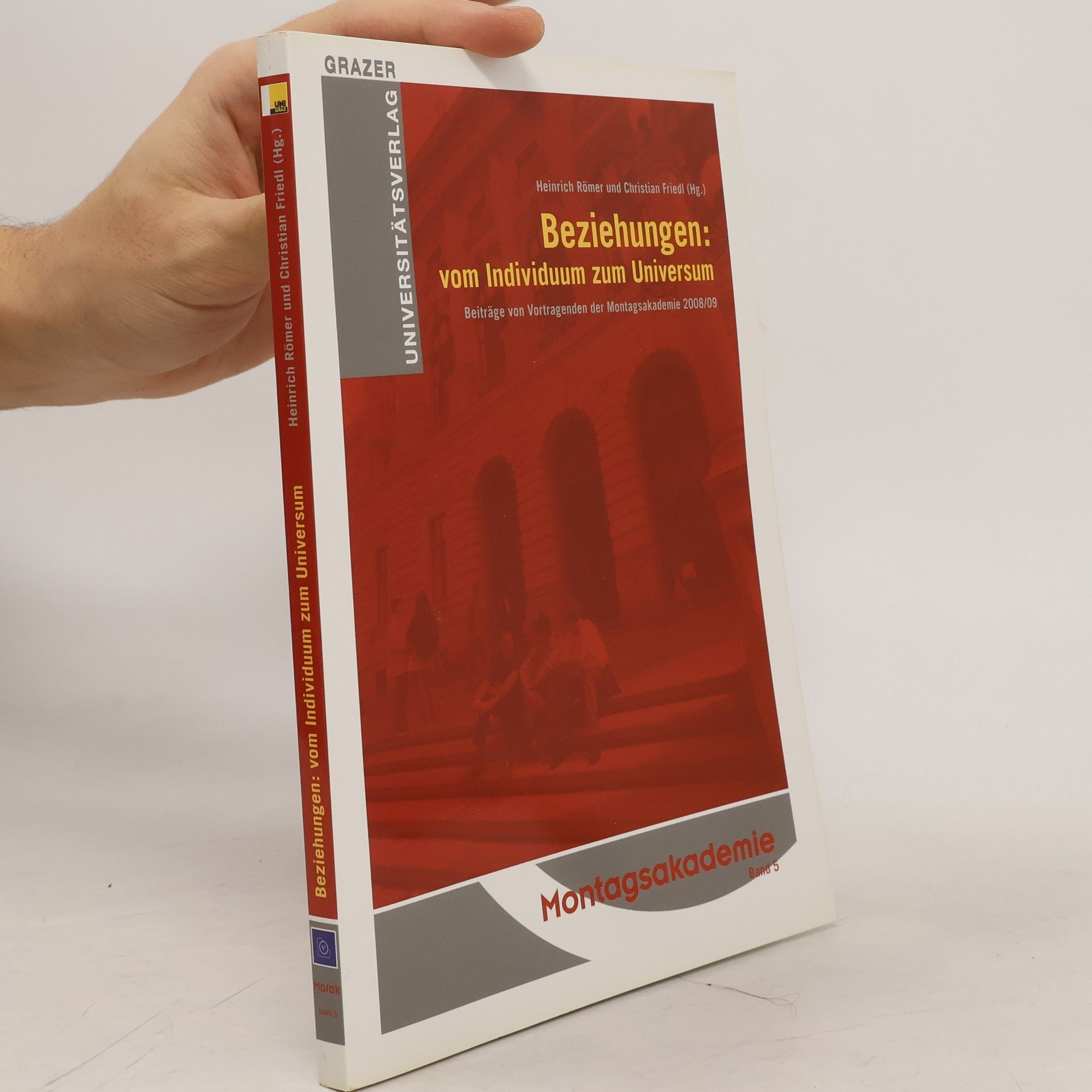Hollywood im journalistischen Alltag
Storytelling für erfolgreiche Geschichten. Ein Praxisbuch
- 300pages
- 11 heures de lecture
Der Band beantwortet die Frage: Was ist eine Geschichte und wie erzähle ich sie am besten? Er greift dabei das zentrale Motiv der „Heldenreise“ auf. Sie ist eine Art Baukasten, aus dem sich Geschichtenerzähler kinderleicht bedienen können. Im Prinzip handelt es sich um eine angereicherte Form der 3-Akt-Struktur nach Aristoteles. Alle berühmten Hollywood-Regisseure benutzen sie, kaum ein Blockbuster kommt ohne sie aus. Was für Hollywood gilt, sollte auch für den Journalismus möglich sein, denn das Übernehmen von Erzählformen ist keine Frage des Geldes. Dieses Buch enthält Drehbuch-Ausschnitte aus Hollywood-Filmen, um die dramaturgischen Strukturen zu erläutern und veranschaulicht anhand von zahlreichen Beispielen aus Fernsehen, Hörfunk und Zeitung, wie man sie im Alltag anwenden kann. Für die zweite Auflage wurden die Filmbeispiele aktualisiert, der theoretische Teil um die Sequenzierung erweitert sowie weitere Beispiele aus dem journalistischen Alltag ergänzt.