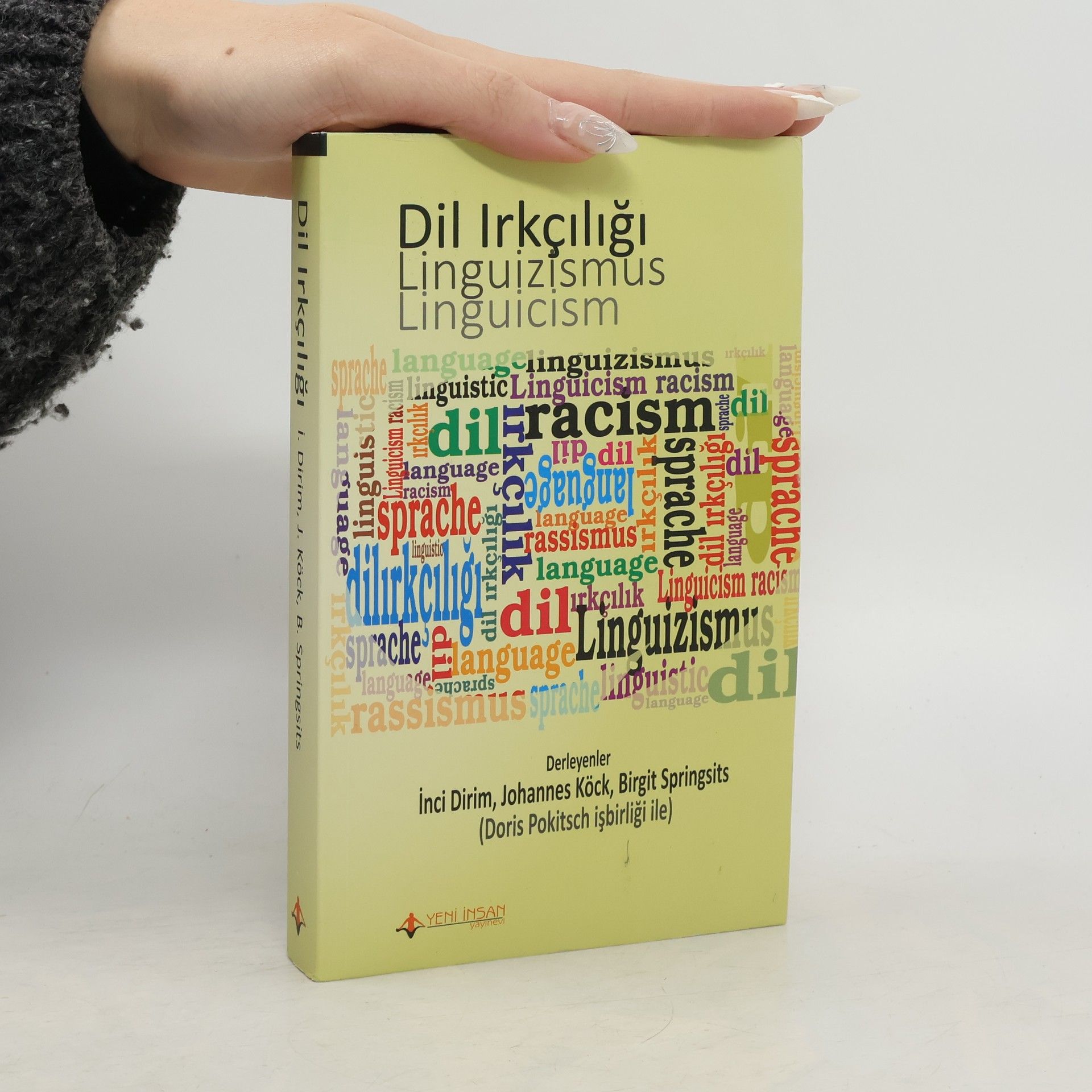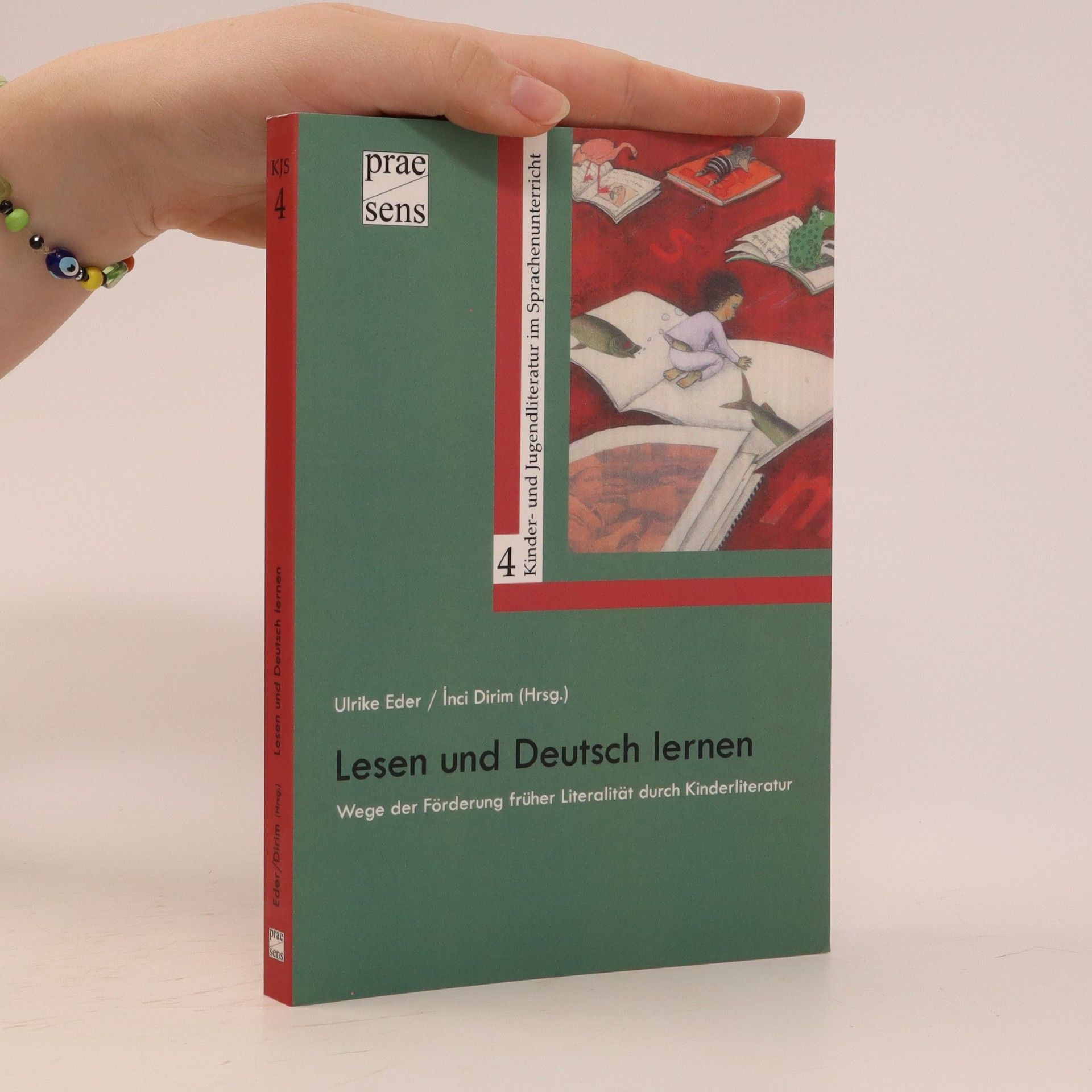Lesen und Deutsch lernen
Wege der Förderung früher Literalität durch Kinderliteratur
In der Migrationsgesellschaft und unter den Bedingungen lebensweltlicher Mehrsprachigkeit steht die Förderung der Literalität vor spezifischen Aufgaben. Aktuelle erwerbstheoretische Untersuchungen zeigen deutlich, dass im Zusammenhang mit der kindlichen Ausbildung medialer und konzeptioneller Schriftlichkeit der Arbeit mit Kinderliteratur im schulischen und familiären Kontext eine grundlegende Bedeutung zukommt. Oftmals müssen Kinder, die in amtlich deutschsprachigen Regionen den Unterricht besuchen nicht nur Lesen und Schreiben, sondern zugleich auch Deutsch lernen. Dieser Sammelband geht der Frage nach, welchen grundlegenden Beitrag Kinderliteratur zur sprachlichen Bildung und Sprachförderung im Deutschen sowie zur literarischen Sozialisation leisten kann. Die einzelnen Beiträge bringen konkrete Unterrichtserfahrungen und ihre empirische Untersuchung in die Diskussion ein und zeigen wichtige Ansätze zu deren lehr- und lerntheoretischer Einbettung.