Klaus Pichler Livres

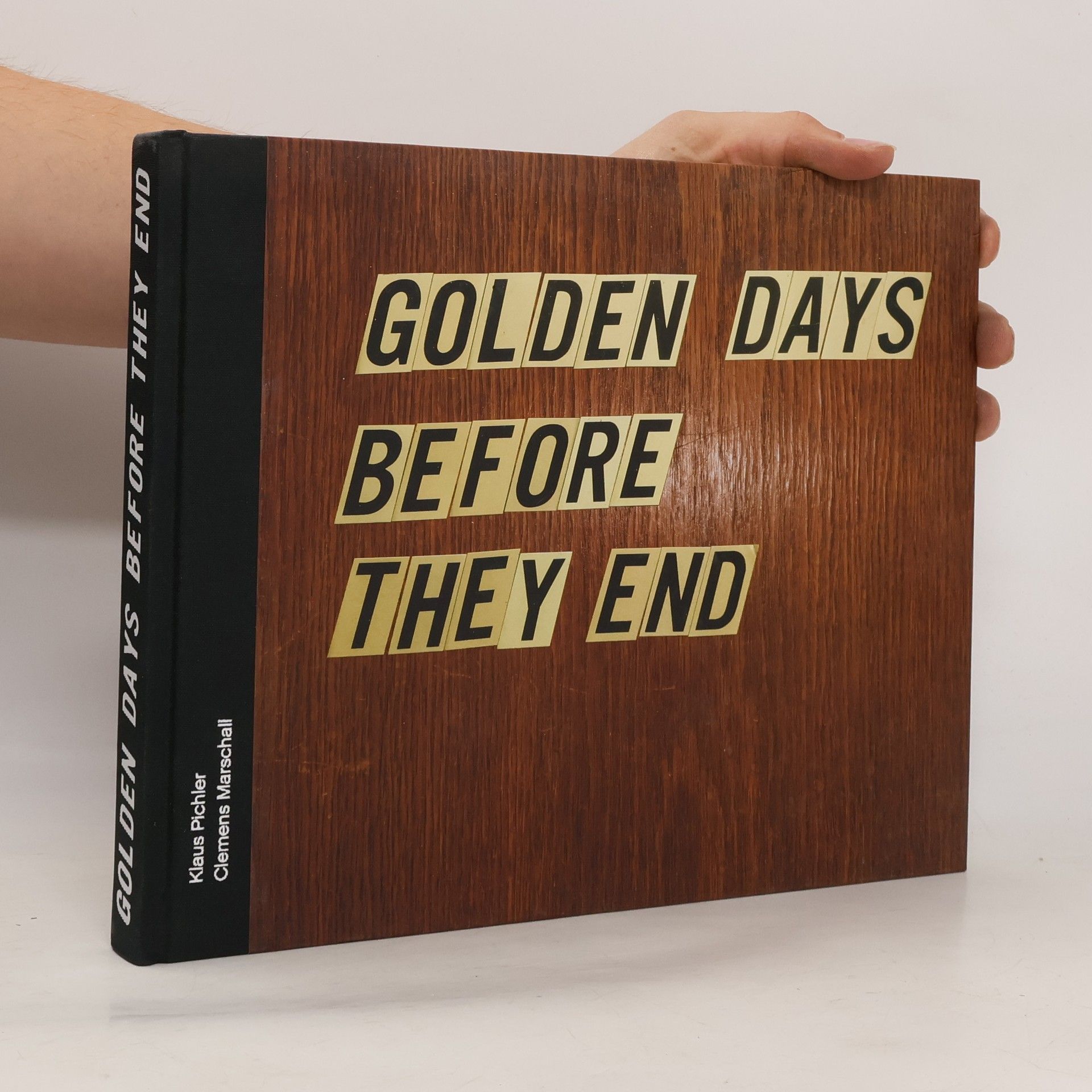
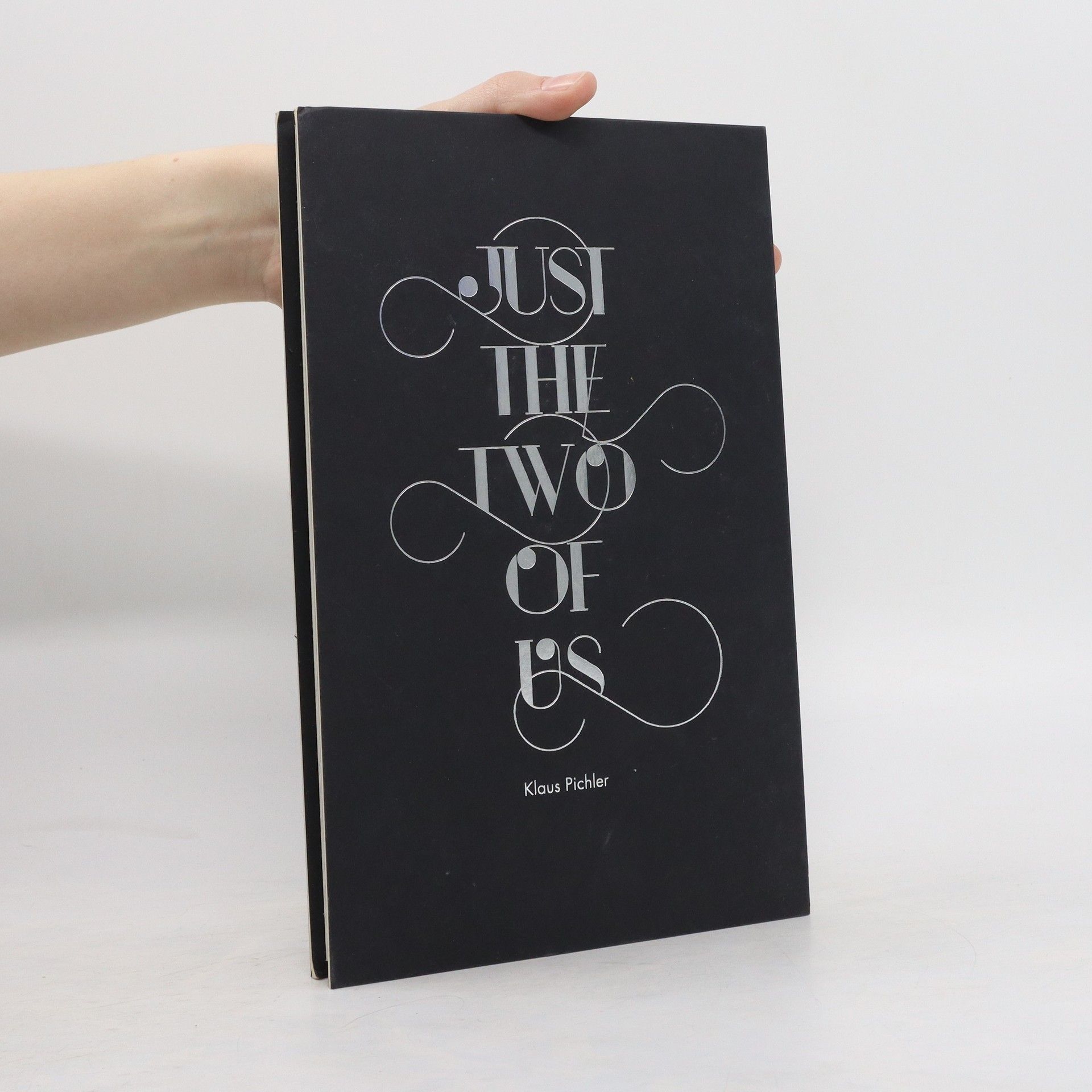

Kykladen
Die malerische Inselwelt in der Ägäis
Die Kykladen sind eine Gruppe von circa 25 bewohnten Inseln in der südlichen Ägäis. Die bekanntesten sind Milos, Mykonos, Naxos und Santorini. Besonders angetan haben es Klaus Pichler allerdings nicht die Inseln mit den berühmten Namen, so schön sie auch sind, sondern die dem Namen nach weitgehend unbekannten. Auf ihnen wird das Ursprüngliche und Genuine der Kykladen sicht- und spürbar: das kristallklare Licht der Ägäis, wo in der Nähe oder Ferne immer eine oder mehrere Inseln zu sehen sind, die leichte Meeresbrise, dazu der Duft der farbenprächtigen Blumenwiesen und Felder, deren im Herbst dunkelgelbe bis braune Farben in wunderbarem Kontrast zum komplementären Blau von Meer und Himmel stehen. In seinen einzigartigen, herausstechenden Fotografien zeigt Klaus Pichler die Menschen, die verschiedenen Landschaften und das beinahe immer gegenwärtige Meer, aber auch die typische kirchliche und profane Architektur sowie Szenen aus dem täglichen Leben, und weckt so bei den Betrachtenden eine beinahe unwiderstehliche Insel-Sehnsucht.