Das Ethische und das Politische
Sozialphilosophie am Leitfaden der Vulnerabilität
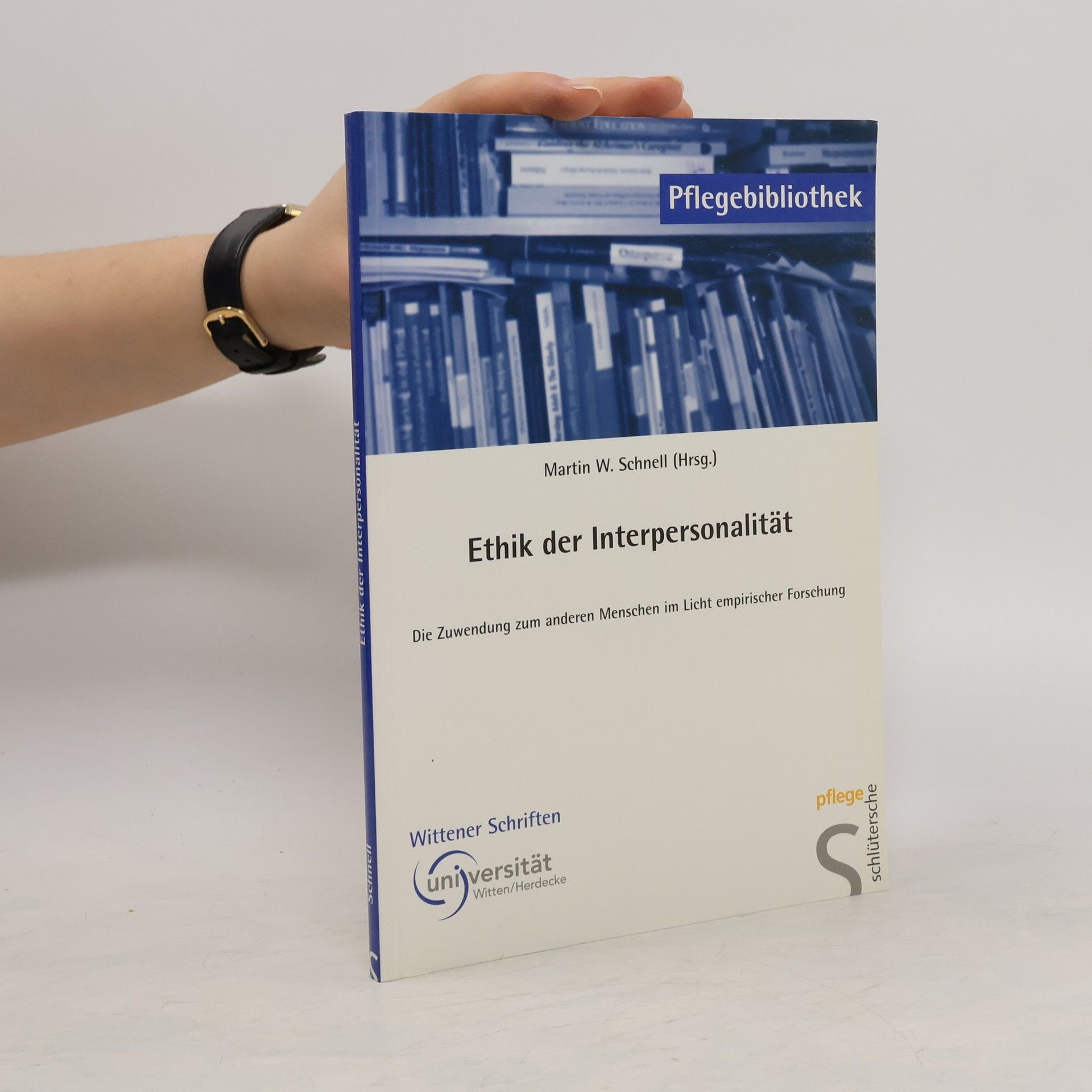





Sozialphilosophie am Leitfaden der Vulnerabilität
Intersubjektivität, Technik, Lebenswelt
Der Begriff Vulnerabilität bezeichnet eine grundsätzliche, nicht aufhebbare Verletzlichkeit, die alle leiblichen Wesen bestimmt: Ich erfahre die Anderen und die Welt, indem sie mir widerfahren. Vulnerabilität ist somit als eine Bedingung des Daseins überhaupt zu begreifen. Martin W. Schnell thematisiert Vulnerabilität an dem Punkt, an dem sie in den Diskurs der Medizin eintritt. Sie ist dann im historisch und gesellschaftlich konkreten Kontext von Behandlung und Gesundheitssystem zu verorten, wo sie häufig nur in Form der Unterscheidung von krank und gesund in den Blick gerät. Aufgabe der Medizinethik ist es, hier an die Verletzlichkeit des Individuums im Verhältnis zum Anderen – sei es der behandelnde Arzt oder die öffentliche Gesundheit – zu erinnern. Das vorliegende Buch präsentiert dazu Studien unter anderem zu folgenden Aspekten: Leiblichkeit, Schmerz, Haut, Alter, Demenz, Sterben, Pflege, Public Health, Corona-Pandemie, Technik und (Post-)Digitalisierung.
Eine Vignettenstudie
Die in diesem Buch präsentierte Studie befasst sich mit der Frage, welcher Zusammenhang zwischen der Bereitschaft besteht, in der COVID‐19‐Pandemie anderen Menschen in deren Lebensvollzug zu helfen und der Furcht vor dem Tod durch COVID‐19. Das Buch gibt eine Antwort auf die Frage nach „Solidarität in der Krise“. Im Rahmen einer Vignettenstudie werden Einwohner*innen Deutschlands mittels Online‐Fragebogen zu soziodemographischen sowie situationsbezogenen Eigenschaften und ihren jeweiligen Vignettenurteilen befragt.
Wenn die kurativen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, bleiben dem Arzt nur noch palliative Maßnahmen und die psychosoziale Begleitung seines Patienten. Für viele Ärzte ist dies eine große Herausforderung. Um schon im Studium auf die Begleitung und Versorgung Sterbender vorzubereiten, wurde die Palliativmedizin als neues Pflichtfach in die Ärztliche Approbationsordnung aufgenommen. Das Lehrbuch geht dabei sowohl auf medizinische als auch auf ethische, rechtliche und soziale Aspekte ein. Der Leser erhält Anleitung zur Kommunikation mit Patienten und Angehörigen, zur Teamarbeit mit Kollegen aus anderen Bereichen wie z. B. Pflege, Psycho- oder Musiktherapie ebenso wie zu speziellen Themen wie Kinder- und Jugendliche am Lebensende und integrativer Palliativversorgung. In allen Bereichen kommt der Interprofessionalität eine besondere Bedeutung zu. Die Autoren geben mit Fragenkatalogen, Ausschnitten aus Patienteninterviews und Leitfäden wertvolle Anregungen und Hilfen.
Ethik als empirisches Phänomen. Eine Studie über Interaktionen zwischen dementen Menschen und Pflegenden. Mitverantwortung in existentiellen und krisenhaften Situationen - Erfahrungen von Angehörigen in der häuslichen Sterbebegleitung mit palliativen Versorgungsstrukturen. Verwantwortungsbewusste Experten und Virtuosen der Empathie? Patientenkontakt auf onkologischen Abteilungen im Vergleich der Berufsgruppen Medizin und Pflege. Von der häuslichen Selbstsorge zum Hausarzt. „Der schlüssige Aufbau der vorgestellten Projekte (u. a. Basale Stimulation, Aromapflege, Gesundheitspädagogik, Beratungsgespräch beim übergewichtigen Kind) ermöglicht die Überprüfung der eigenen Arbeitsweise und gibt Hinweise, wie die Beratung und Unterstützung der Patienten verbessert werden kann. Es verdeutlicht auch, wie stark Beratung und Pflege miteinander verbunden sind.“ Zeitschrift für Wundheilung (August 2005)