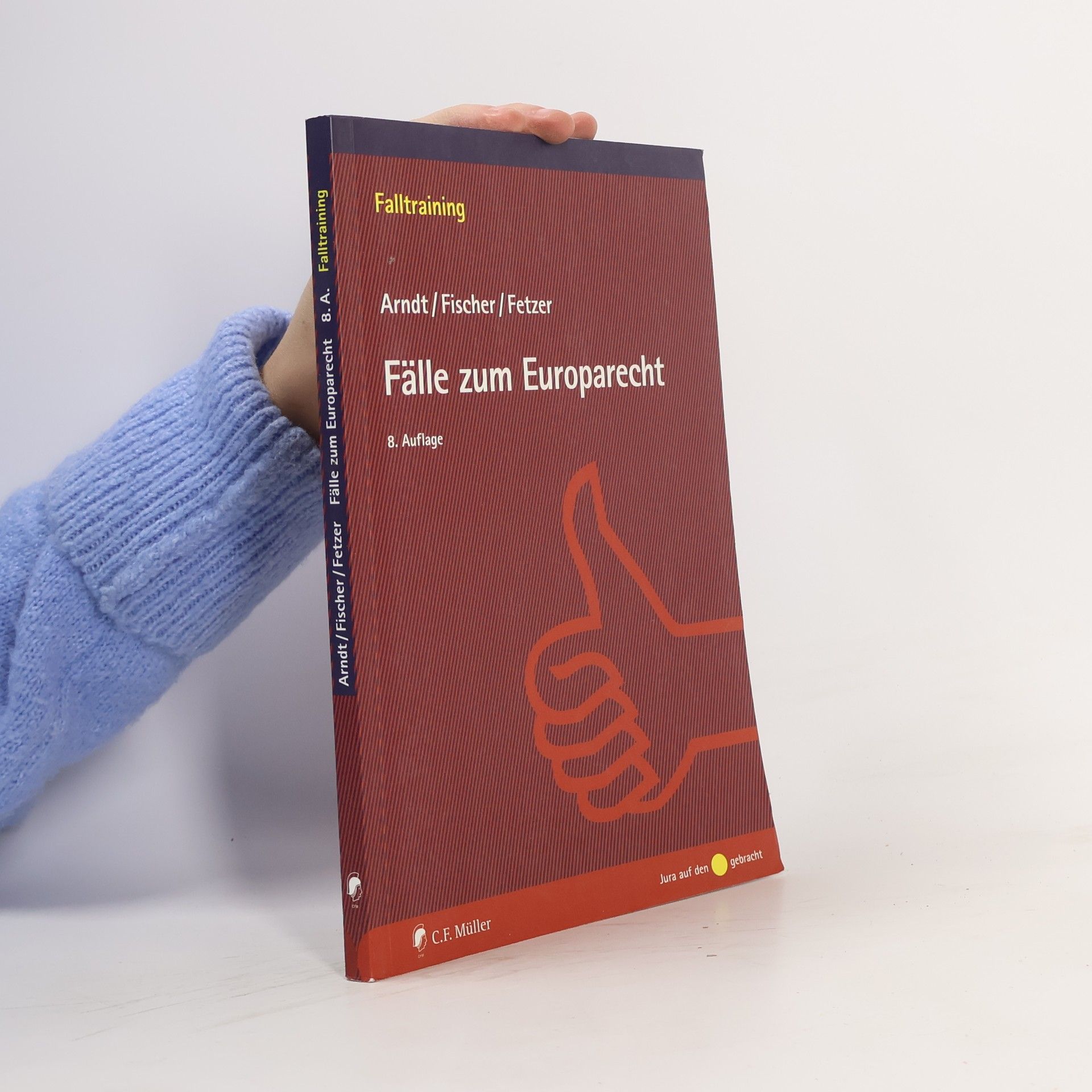TKG
TelekommunikationsgesetzKommentar
Der Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze hat auch die hohe Dynamik des Telekommunikationsrechts weiter beschleunigt - etwa bei den Änderungen zur Mitnutzung vorhandener und alternativer Infrastrukturen durch das DigiNetzG bzw. das 5. TKGÄndG. Doch sorgen auch weitere Entwicklungen derzeit für viel Bewegung im TKG: von Neuregelungen zu Endgeräten über Einflüsse wichtiger europäischer Verordnungen bis hin zu den neuesten Änderungen durch das 6. TKGÄndG.Der Berliner Kommentar TKG behält das Geschehen für Sie konsequent im Blick: Neben einer konkurrenzlos aktuellen Kommentierung des TKG zum Erscheinen des Werks finden Sie auch die Entscheidungspraxis der Bundesnetzagentur und der Gerichte detailliert berücksichtigt. Neu kommentiert in der 3. Auflage sind u.a. :- Netzneutralitäts-VO, Roaming-VO und die Regelungen zu Intra-EU Calls- 77q, 77r TKG zur Mitnutzung vorhandener und alternativer Infrastrukturen (DigiNetzG bzw. 5. TKGÄndG)- 41b, 41c TKG bzw. die Neuregelungen zu Endgeräten- 6. TKGÄndG und sich daraus ergebende Anpassungen im TKGAuch schon absehbare Änderungen durch den Europäischen Kodex für die Elektronische Kommunikation sind bereits eingebunden.Exzellentes Netzwerk: Renommierte Herausgeber und ein ausgewogener Autorenkreis aus Anwaltschaft, Justiz, Bundesnetzagentur und Forschung bürgen für fachliche Kompetenz und viel Praxisnähe.