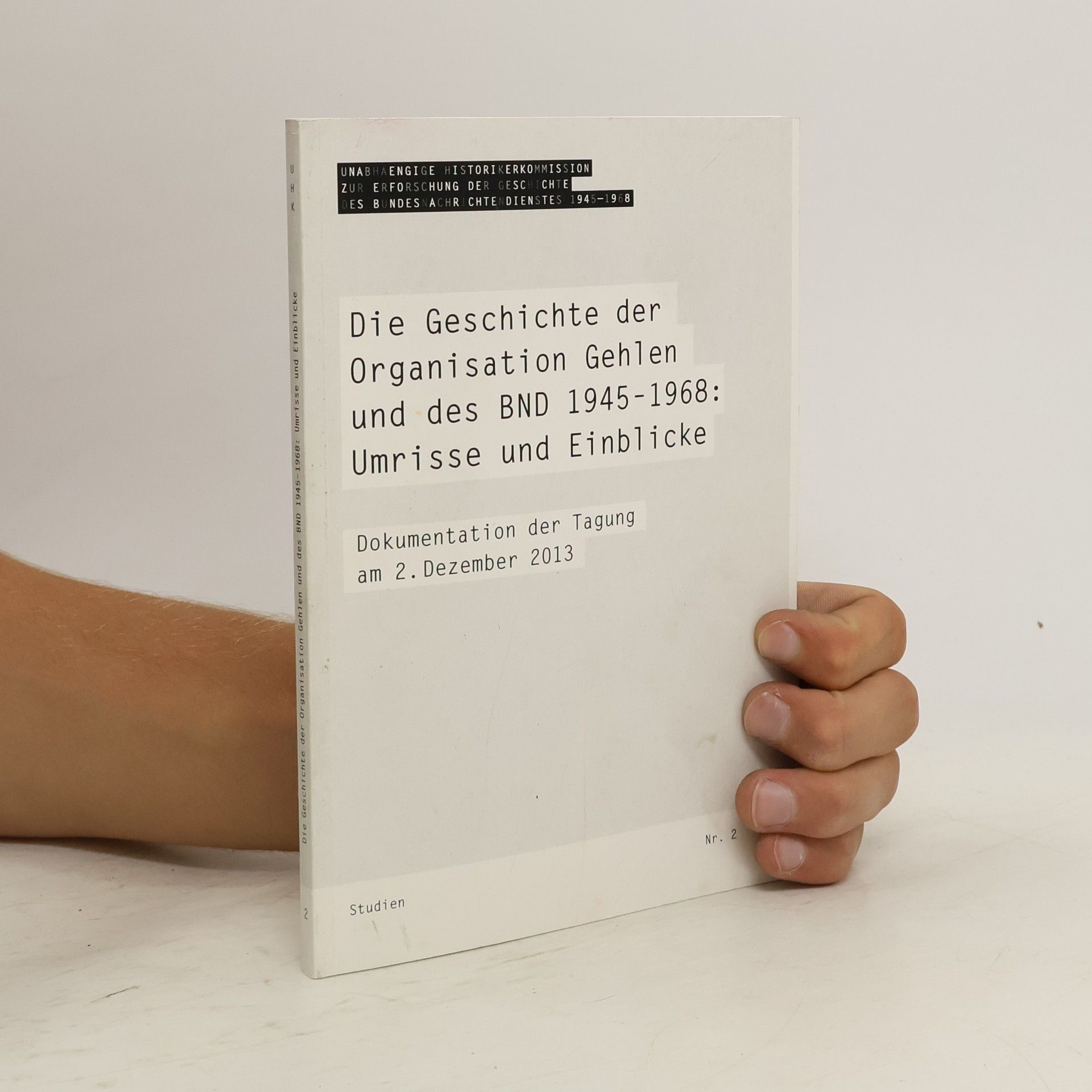Internationale Geschichte seit 1945
- 325pages
- 12 heures de lecture
Die internationale Geschichte seit 1945 zeichnet sich durch eine stete Zunahme relevanter Akteure Neben Regierungen und internationalen Organisationen beeinflussten u. a. Unabhangigkeitsbewegungen, Nichtregierungsorganisationen und multinationale Unternehmen das globale Geschehen. Mit der Vielfalt der Akteure korrespondiert eine Vielzahl widerspruchlicher Erzahlungen der internationalen Geschichte. Ihre Geschichtsbilder werden zudem durch den Wandel der Medienkultur bestimmt. Andreas Hilger liefert fur die Zeit vom Zweiten Weltkrieg bis Mitte der 2010er Jahre einen konzisen Uberblick uber die wesentlichen, oft konfliktreichen internationalen Entwicklungen und ihre Trager. Fallstudien u. a. zu Foto-Ikonen und Erinnerungsparks thematisieren widerspruchliches Erinnern und seine mediale Pragung in der globalen Gesellschaft und Politik.