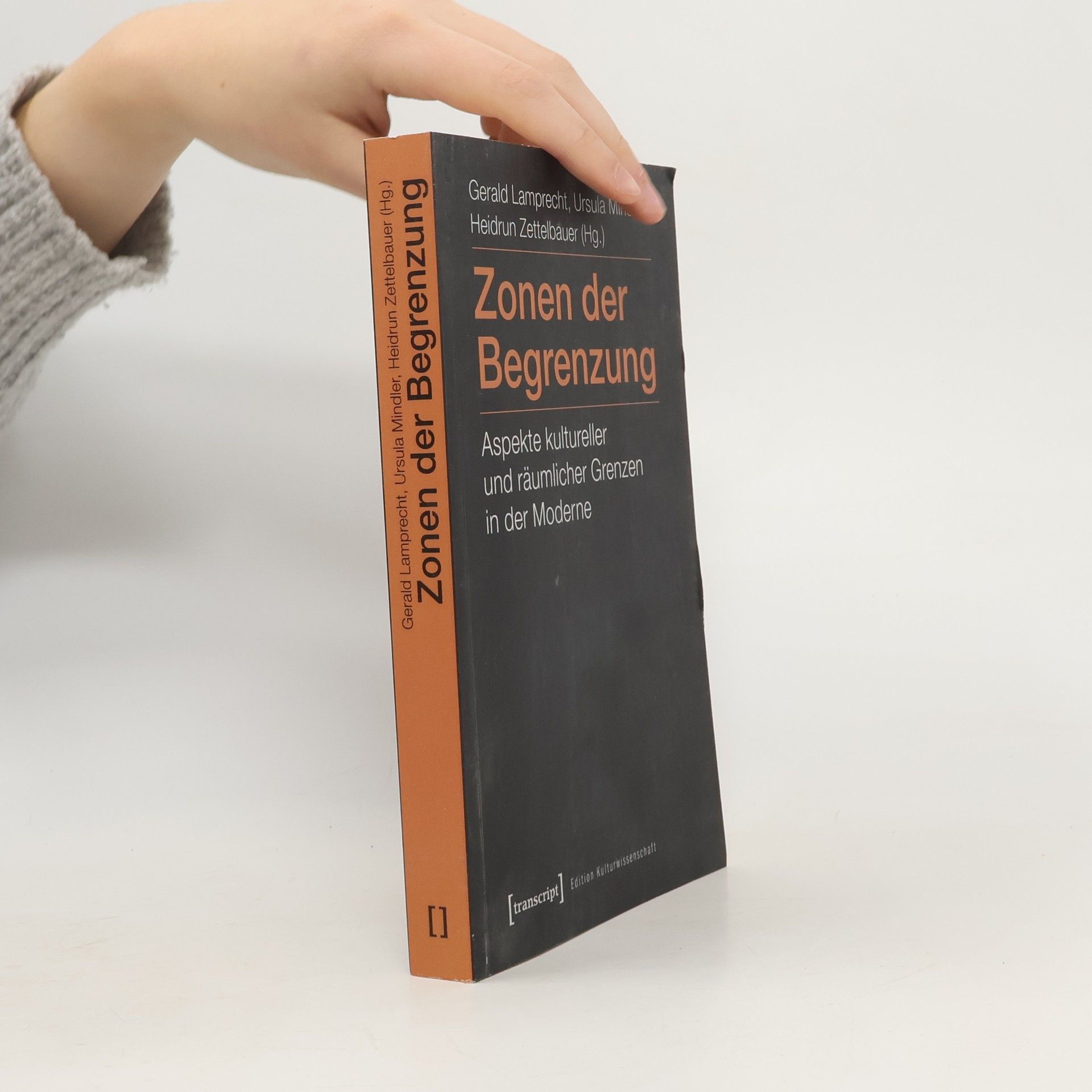Nachkriegserfahrungen
Exklusion und Inklusion von Opfer- und Täter-Kollektiven nach 1945
Die Etablierung einer demokratischen Nachkriegsordnung nach dem gewaltsamen Ende des NS-Regimes stellte die österreichische Politik und Gesellschaft vor vielfältige Herausforderungen. Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren es vor allem Fragen nach dem gesellschaftlichen Umgang mit den ehemaligen NationalsozialistInnen ebenso wie den tausenden Displaced Persons und Flüchtlingen. Die Beiträge dieses Heftes setzen sich am Beispiel der Steiermark mit Fragen der Entnazifizierung der Universitäten und Schulen ebenso auseinander wie mit der Situation jüdischer DP`s sowie den Kontinuitäten des Antisemitismus im Rahmen der justitiellen Aufarbeitung von NS-Gewaltverbrechen.