Tiergestützte psychodynamische Psychotherapie
Mensch-Tier-Beziehungen: Freunde fürs Leben
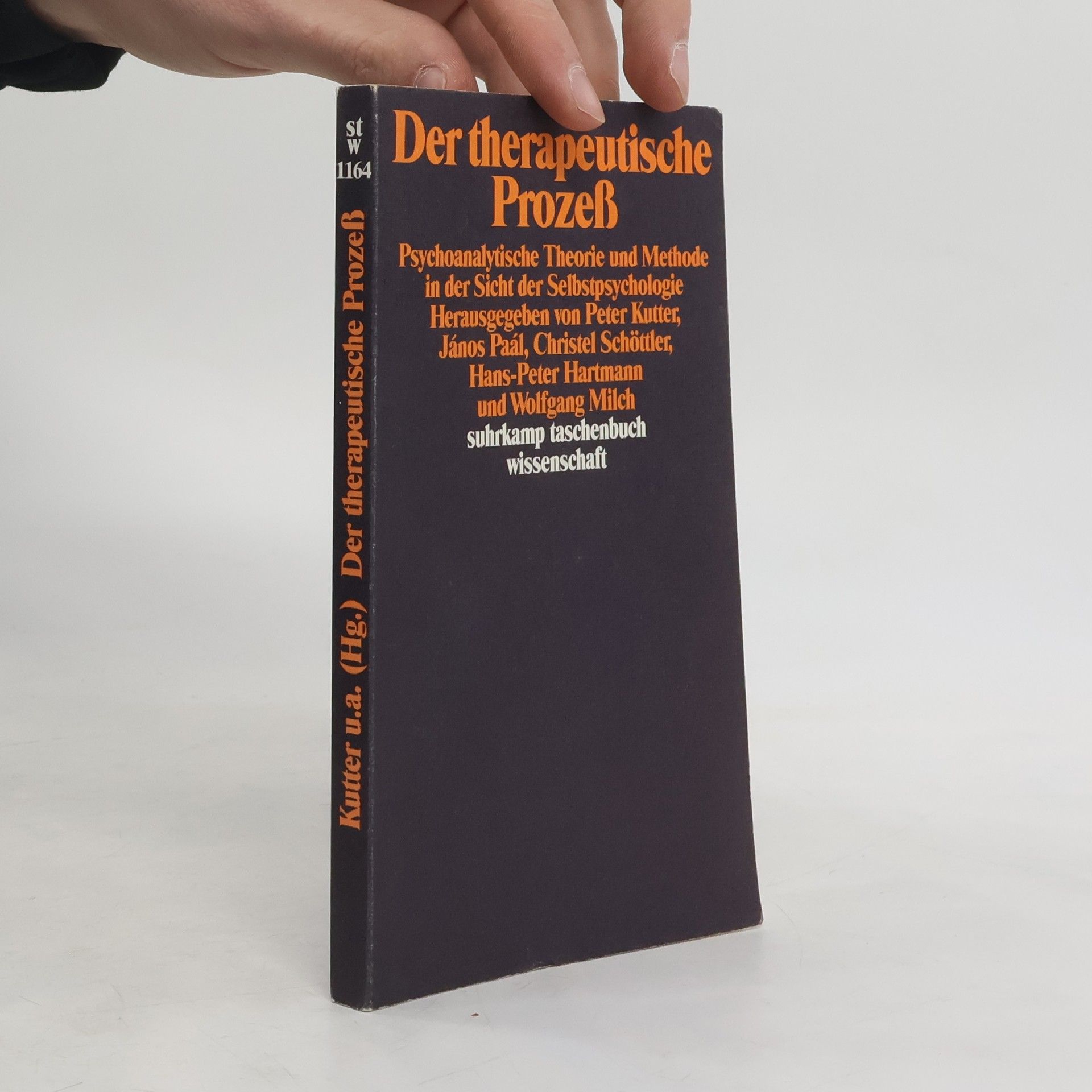


Mensch-Tier-Beziehungen: Freunde fürs Leben
Dieses Lehrbuch ist eine gut verständliche Einführung in die psychoanalytische Selbstpsychologie und die Intersubjektive Psychoanalyse. Es stellt umfassend die grundlegenden Konzepte der ursprünglich von Heinz Kohut (1913-1981) begründeten Selbstpsychologie dar und wendet sie auf wesentliche Krankheitsbilder an. Der Leser erhält einen Einblick in die unterschiedlichen Linien, die sich seit den 1980ern entwickelt haben, in die wichtigsten Kontroversen und Forschungsthemen. Das Buch richtet sich gleichermaßen an Lehre und Praxis, indem es die Erkenntnisse der modernen Säuglings- und Kleinkindforschung sowie der Neuroforschung im Hinblick auf den therapeutischen Prozess detailliert erörtert.