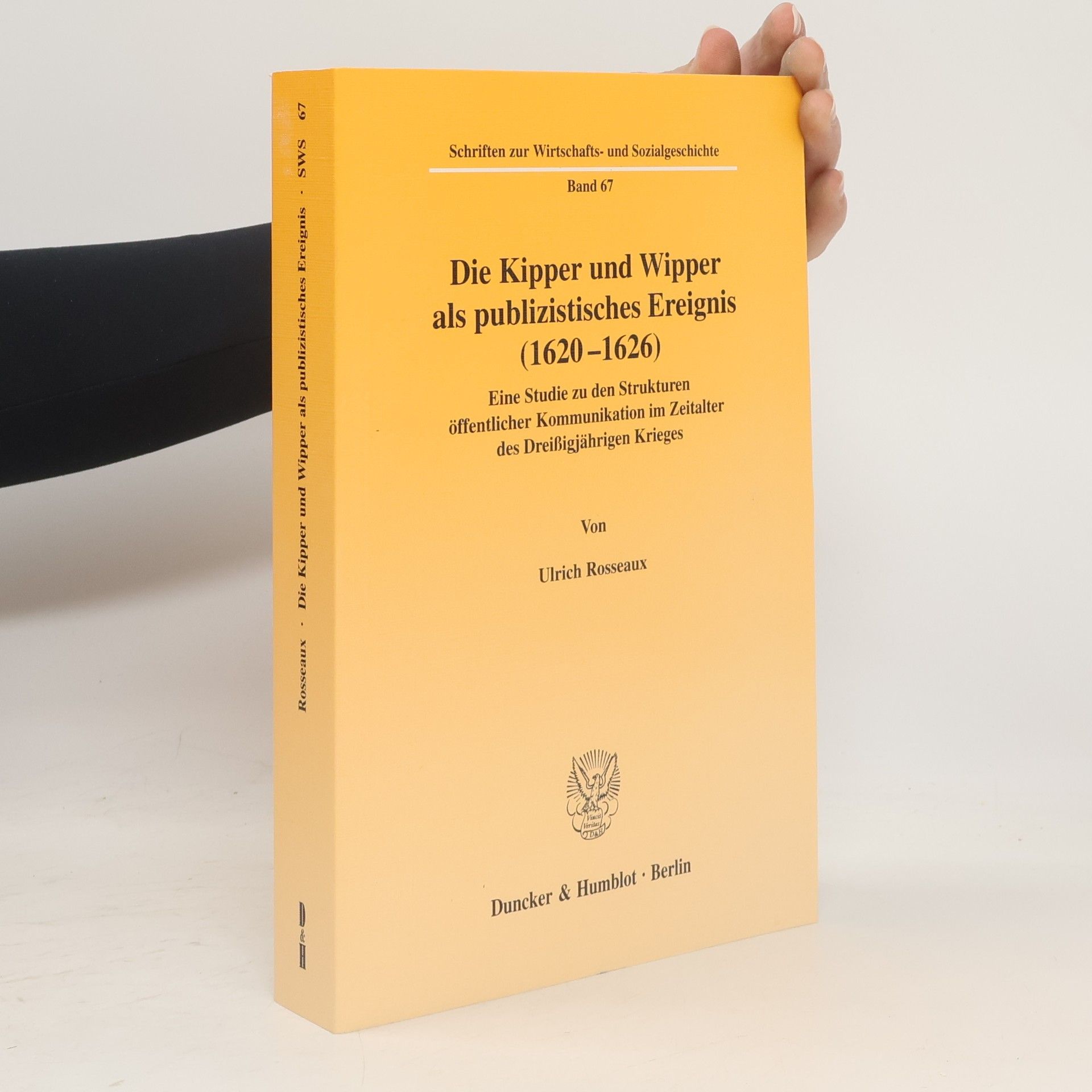Zwischen 1620 und 1623/24 litt das Heilige Römische Reich unter einer Münzverschlechterung, bekannt als Kipper- und Wipperinflation. Diese Teuerung wurde von einer umfangreichen publizistischen Reaktion in Form von Flugschriften, Flugblättern, Zeitungen und Meßrelationen begleitet. Die Analyse dieser facettenreichen medialen Verarbeitung des Inflationsphänomens ist das zentrale Thema dieser Untersuchung. Erstmals wird der frühneuzeitliche Medienmarkt in seiner gesamten Breite betrachtet, wodurch die differenzierten Funktionen der einzelnen Medienformen herausgearbeitet werden. Auch die im Kommunikationsprozess agierenden Personen und Gruppen, wie Drucker, Verleger und Autoren, werden auf Basis neu erschlossener Quellen untersucht. Im Fokus stehen die soziologische Einordnung und die Motivation zur Teilhabe am Medienmarkt. Zudem werden die Verbindungen zwischen den Akteuren des Medienmarktes hinsichtlich netzwerkähnlicher Strukturen analysiert. Ein weiterer zentraler Bereich sind die oft vernachlässigten Fragen zu Preisen und Auflagenhöhen der verschiedenen Medien. In Verbindung damit wird auch die Rezeption dieser Druckwerke erforscht, wobei die unterschiedlichen Mentalitäten und die niedrigere Reizschwelle der frühneuzeitlichen Menschen berücksichtigt werden. Diese Arbeit bietet einen fundierten Einblick in die Strukturen der öffentlichen medialen Kommunikation im frühen 17. Jahrhundert und ist ein wichtiger Beitrag zur Medie
Ulrich Rosseaux Livres
1 janvier 1968