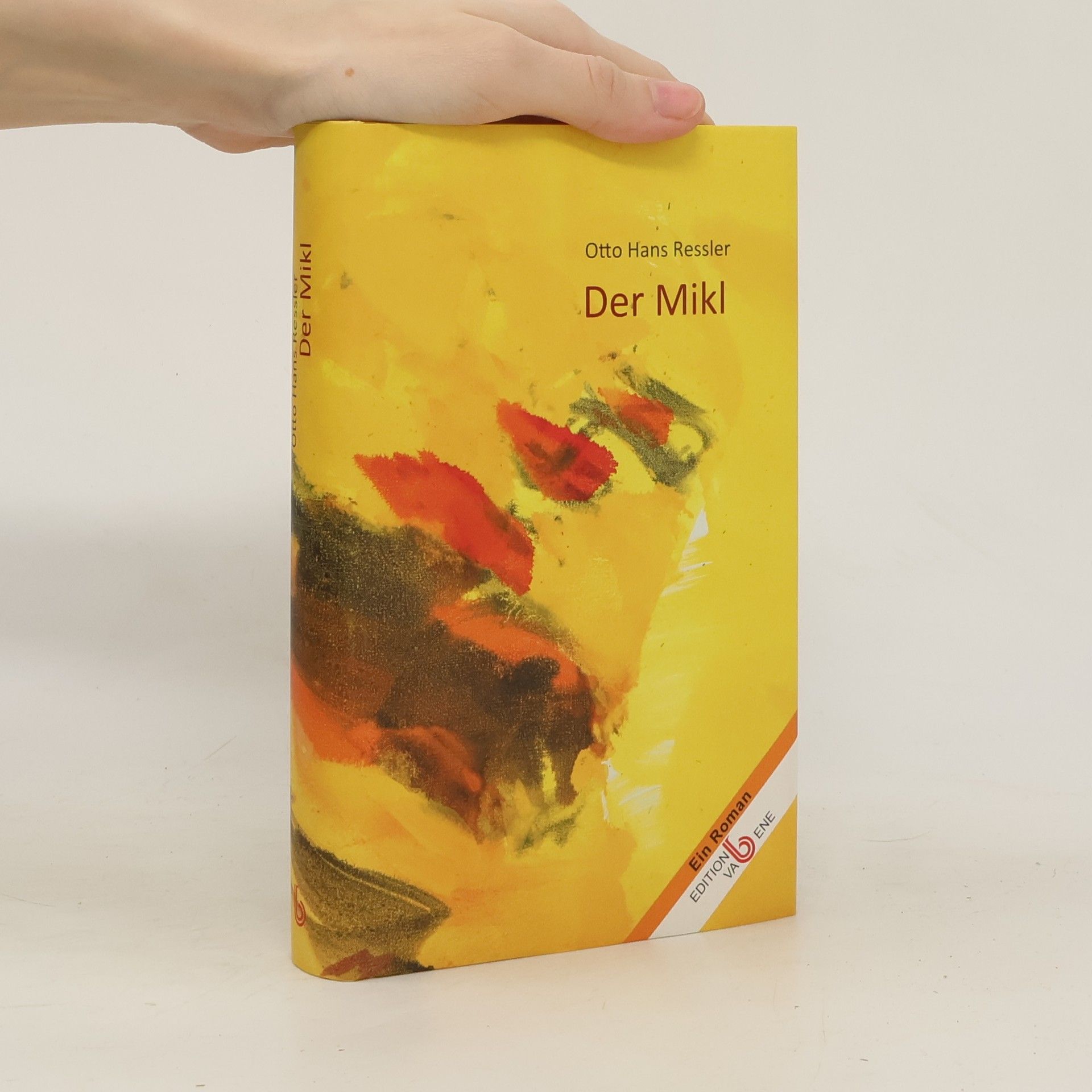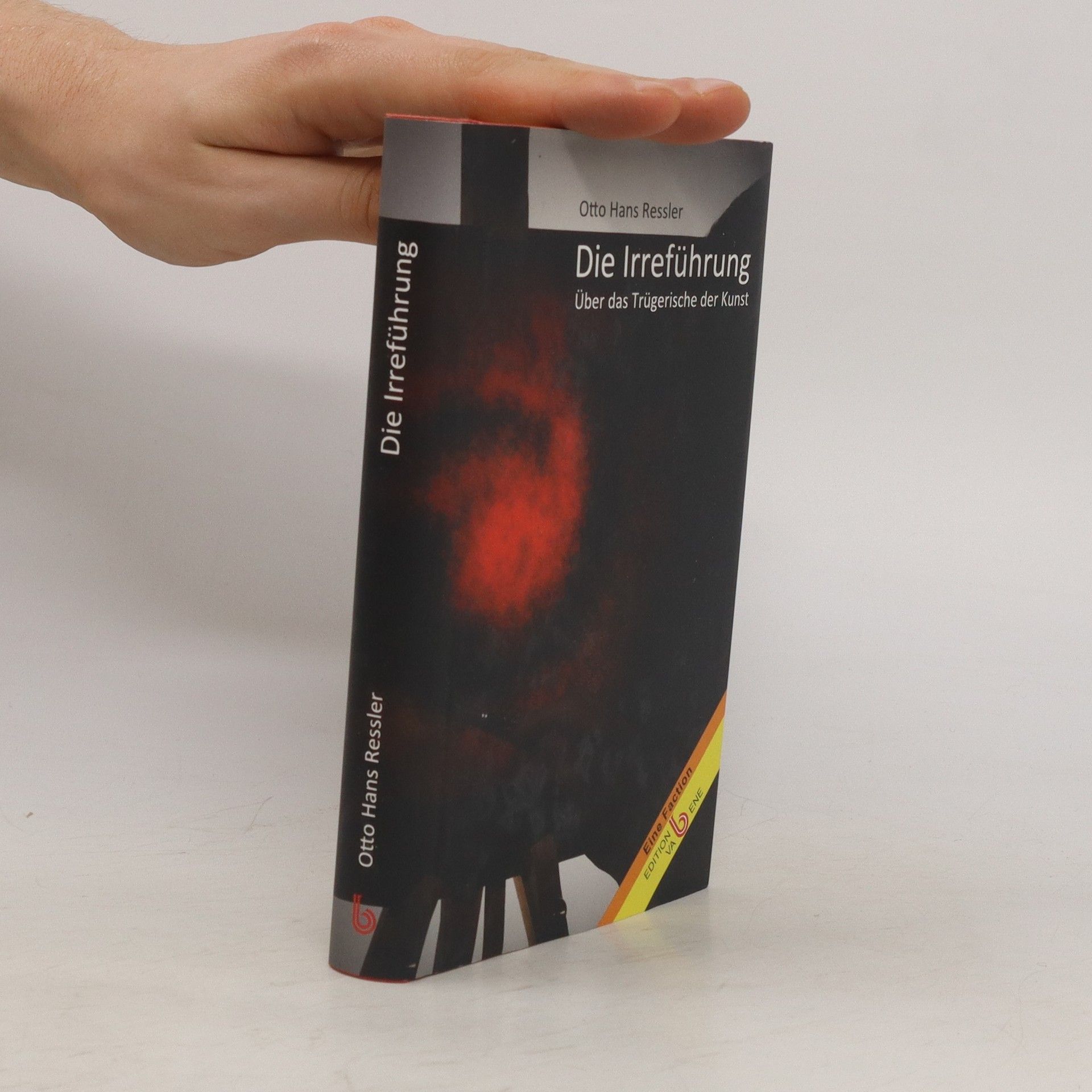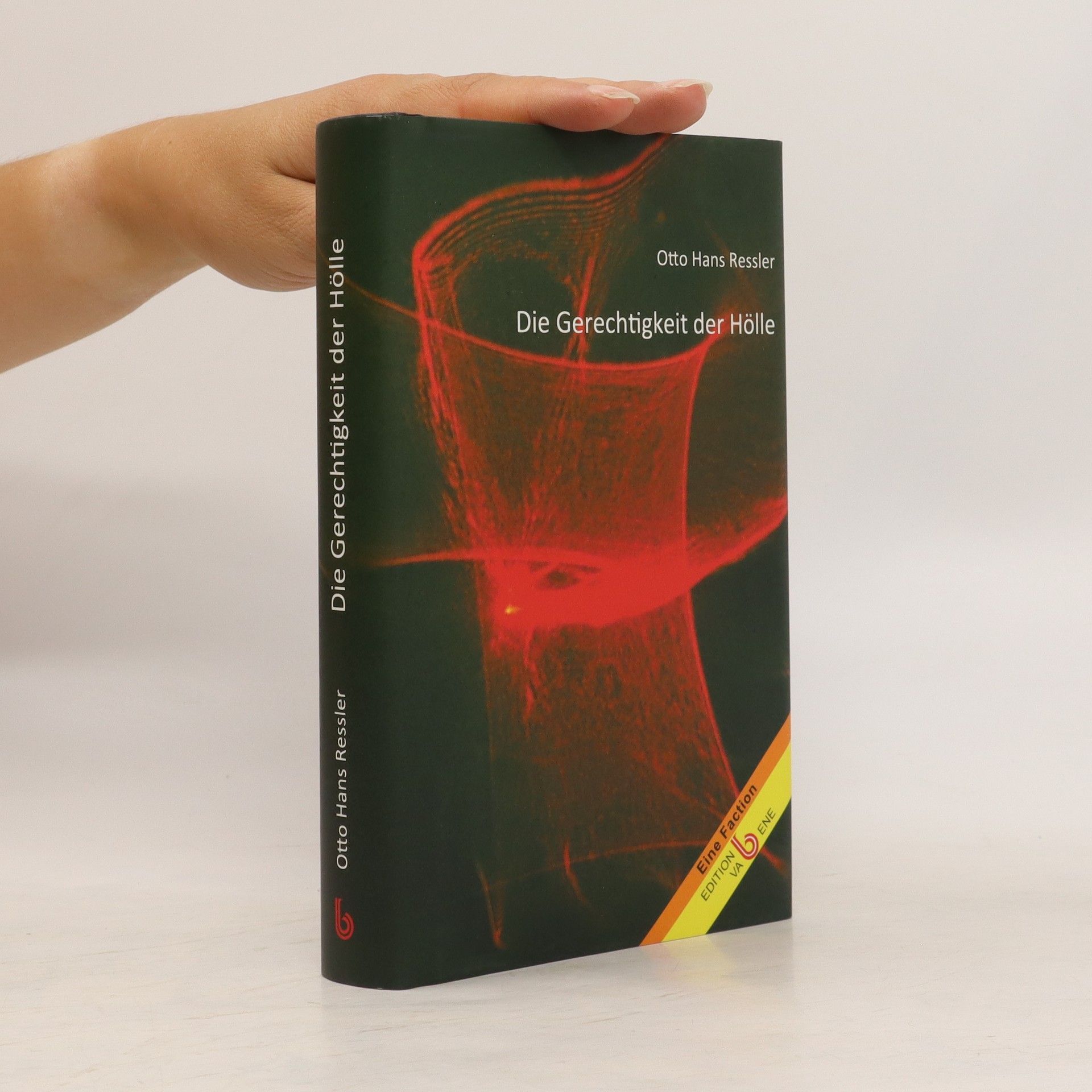Otto Hans Ressler Livres
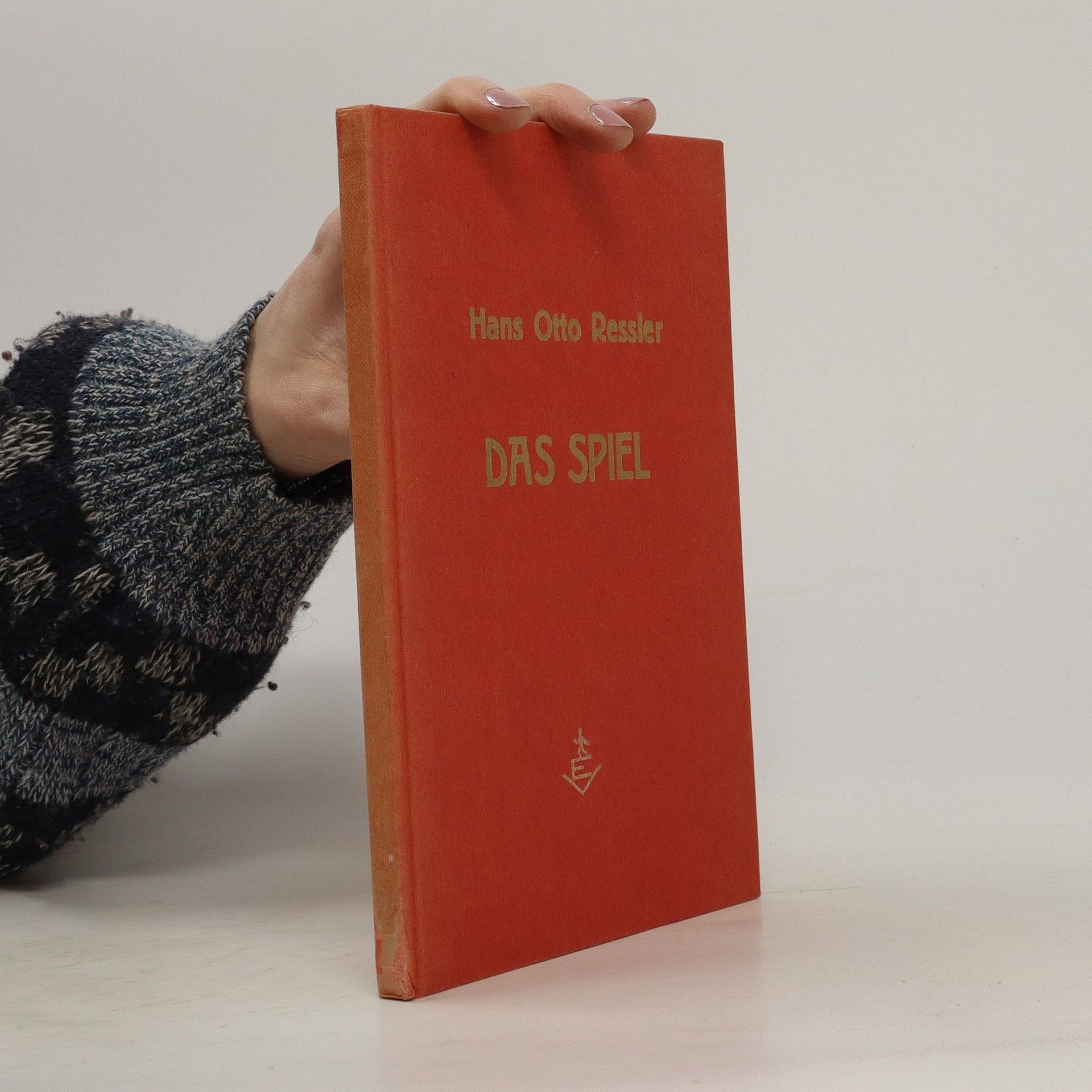
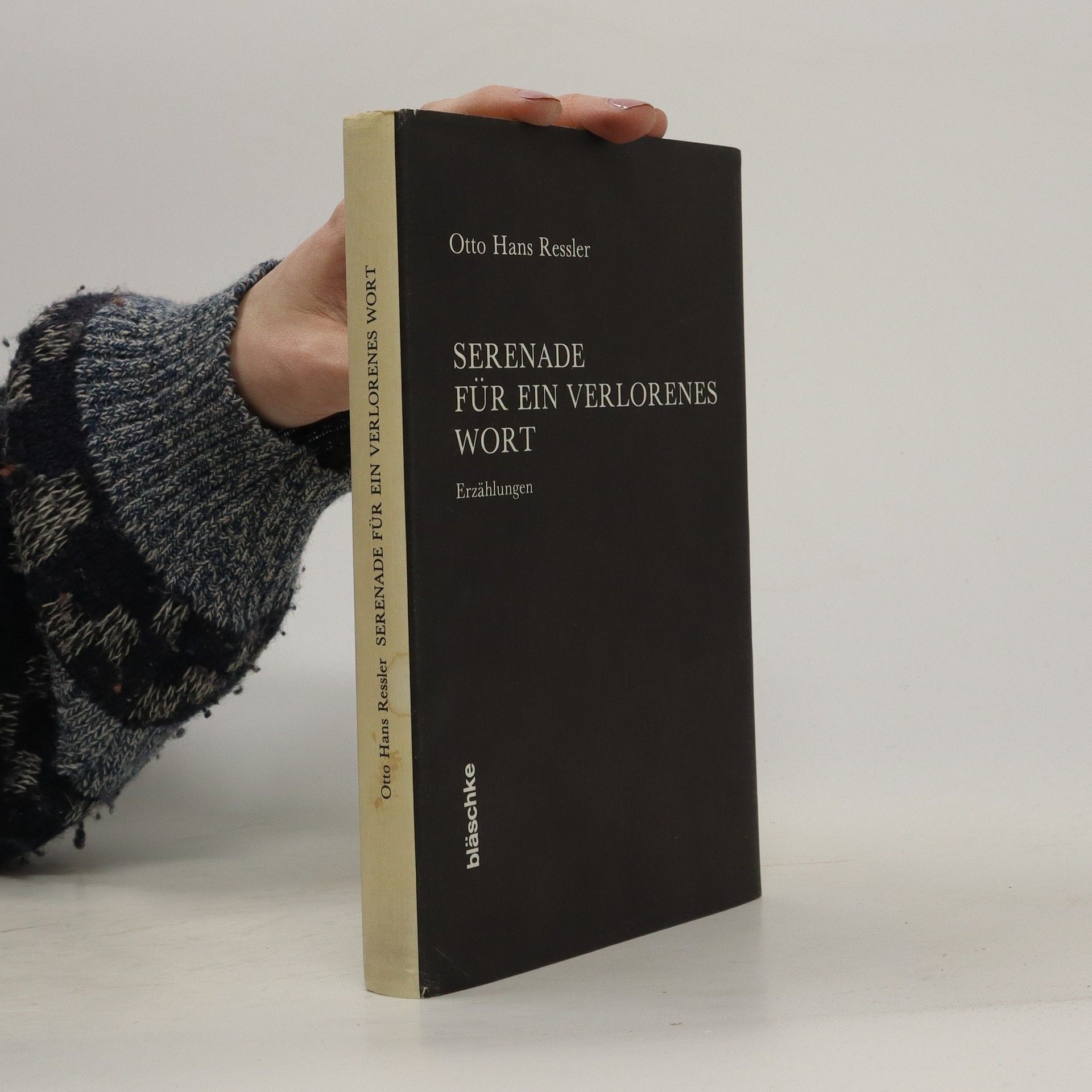
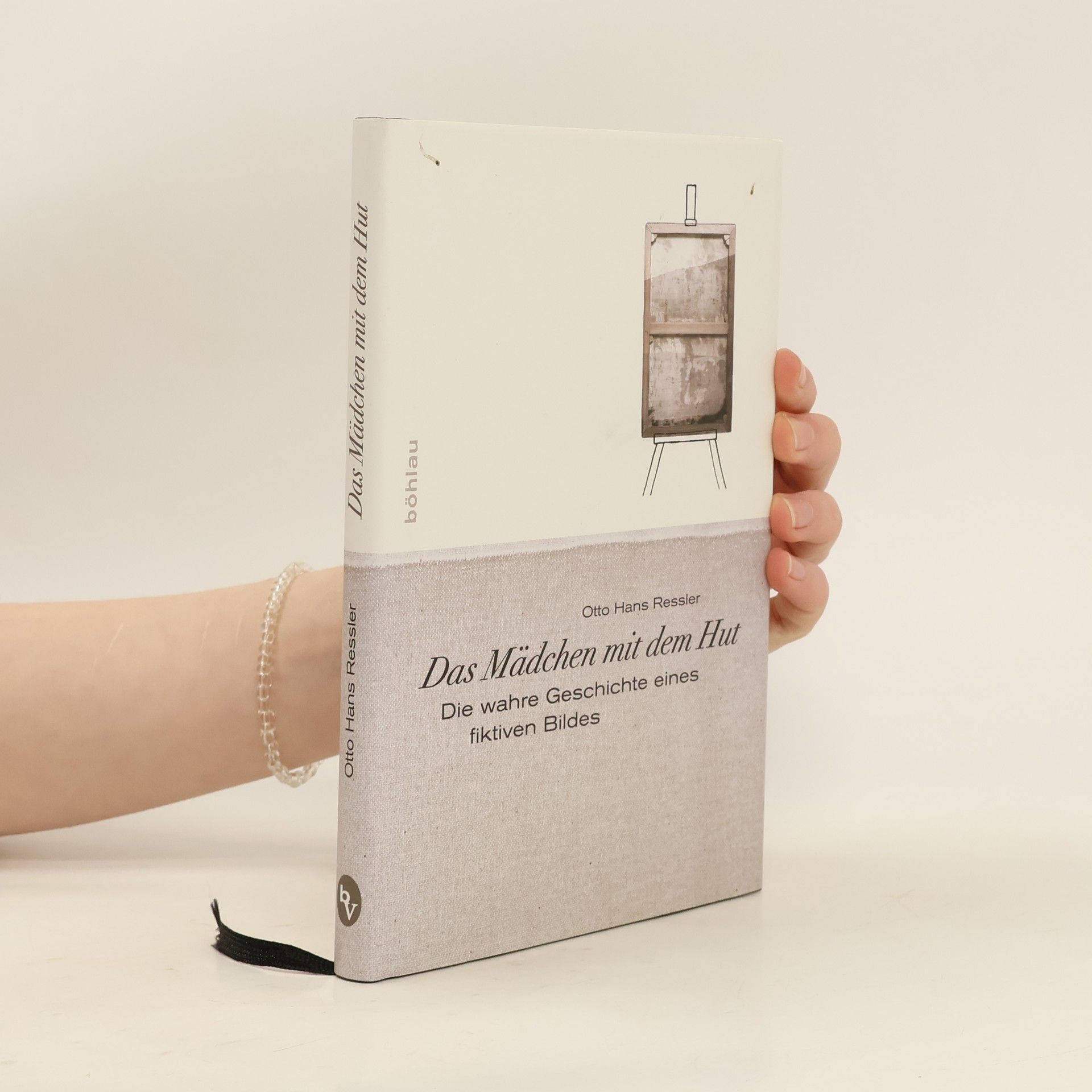
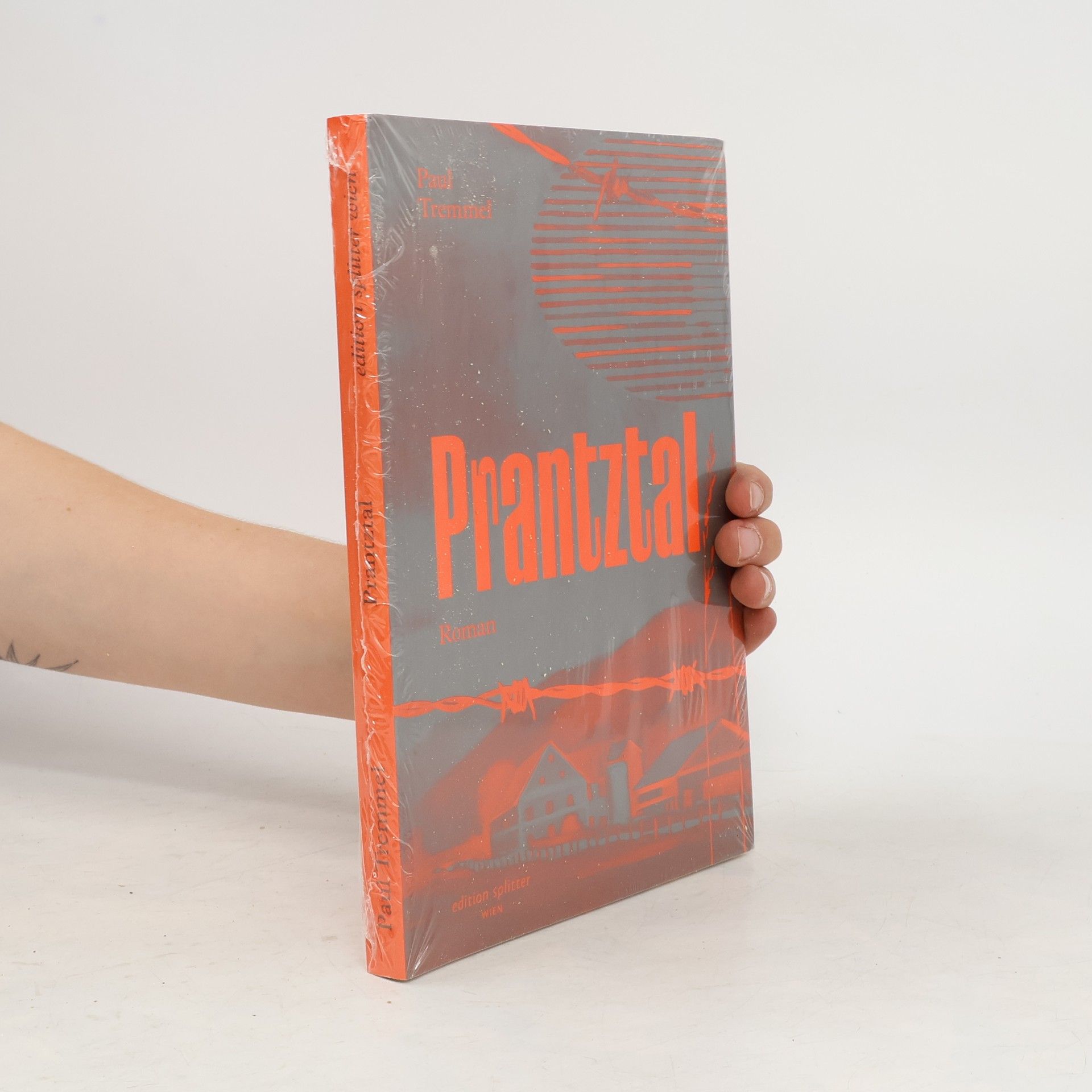


Der Protagonist verabscheut die Aufmerksamkeit der Medien, die nach einem alten Skandal um Valerie wieder auf ihn fokussiert sind. Die Berichterstattung ist sensationsgierig und verzerrt, während der Kunstmarkt auf seine Werke reagiert. Er fühlt sich von Gerüchten und Halbwahrheiten umgeben und leidet unter dem versteckten Hass der Journalisten.
Der Titel des Buches ist ein Zitat aus dem Roman Das unbekannte Meisterwerk von Honoré de Balzac. Dieser beschreibt darin die Ratlosigkeit, ja, das Entsetzen der Fachwelt angesichts eines abstrakten Gemäldes – 80 Jahre, bevor Wassily Kandinsky das erste abstrakte Gemälde tatsächlich malte. Dort endet unsere Kunst ist ein Buch über die Kunst und ihren Markt, über Künstler und Sammler, Kunstliebhaber und Kunstverächter, über das Elend und den Triumph der Kunst. Es ist ein Buch voller Geschichten und Anekdoten, und voller Versuche, das Phänomen Kunst zu ergründen. Dort endet unsere Kunst ist eine Hymne an die Kunst. Dabei werden die Schattenseiten des Kunstbetriebes nicht ausblendet.
Das Mädchen mit dem Hut
- 133pages
- 5 heures de lecture
Wahre Kunst ist einzigartig und unwiederholbar. Wer Kunst kauft, erwartet ein Original, da nur dieses das Verlangen nach Einzigartigkeit befriedigt. Eine Kopie wäre peinlich, eine Fälschung eine Katastrophe. Der Kunstmarkt basiert auf den Begriffen Originalität, Einzigartigkeit und Echtheit, die entscheidend für die oft exorbitanten Preise sind. Ein Original kostet das Hundertfache einer Kopie, während Fälschungen praktisch wertlos sind. Die Geschäftsgrundlage von Galeristen, Händlern, Kuratoren, Auktionatoren und Sammlern ist der Mythos der Aura des Originals, das als Ausdruck der Schöpferkraft des Künstlers gilt. Der Wert eines Kunstwerks ergibt sich aus seiner Bedeutung als Symbol für das Ideal des freien schöpferischen Individuums. Doch was geschieht, wenn zwischen echtem und gefälschtem Kunstwerk nicht unterschieden werden kann, weil die Fälschung authentisch wirkt? „Die Irreführung“ erzählt von Max Tormeister, der vom einfachen Leben zum erfolgreichen Galeristen aufsteigt, aber Rückschläge erleidet, als er Schiele-Fälschungen kauft. Er nimmt den gescheiterten Künstler Ernst Pfeiffer, der zum Fälscher wurde, unter seine Fittiche. Gemeinsam geben sie Pfeiffers abgelehnte Werke als die eines verschollenen ungarischen Künstlers aus. Der Plan gelingt, bis Zweifel an der Existenz des Künstlers aufkommen. Die Charaktere sind fiktiv, doch die Handlung und der Markt sind real.
Der Bildhauer Jakob Thurner hat nicht mehr lange zu leben und diktiert auf seinem Krankenbett seine Erinnerungen. Diese reichen von seiner Kindheit in einem Tiroler Bergdorf bis zu seinem Aufstieg als Bildhauer und Emailkünstler in Wien. Thurner ist nicht an „schönen Bildern“ interessiert, sondern an der Magie und dem Geheimnis der Kunst. In den späten 1960er Jahren entdeckt er den Computer als „magisches“ Werkzeug, was seine Art, Kunst zu schaffen, revolutioniert. Neben seiner künstlerischen Laufbahn erzählt er von seinem Leben: den Entbehrungen im Ersten Weltkrieg, seiner Beziehung zu Valerie, den politischen Umwälzungen der 1930er Jahre, den Übergriffen der Nazis, seiner Berufung an die Krakauer Akademie und der Flucht vor der Roten Armee. Jakob Thurner ist keine reine Kunstfigur; seine Intentionen basieren auf den Aufzeichnungen des Bildhauers und Computerkünstlers Otto Beckmann. Dennoch ist die Erzählung kein Biographie, sondern ein Künstlerroman. Für einen Künstler zählt nur eines: die Qualität des Werkes. Die Bewertung obliegt den Kritikern und Fachleuten, doch der Künstler selbst ist sein eigener Maßstab. Diese innere Messlatte ist sowohl eine Herausforderung als auch das immense Potential der Kunst. Otto Hans Ressler, 1948 geboren, war in leitenden Funktionen im Grazer und Wiener Dorotheum tätig und ist gerichtlich beeideter Kunstsachverständiger. 1993 gründete er das „Auktionshaus im Kinsky“ in Wien und widmet sich