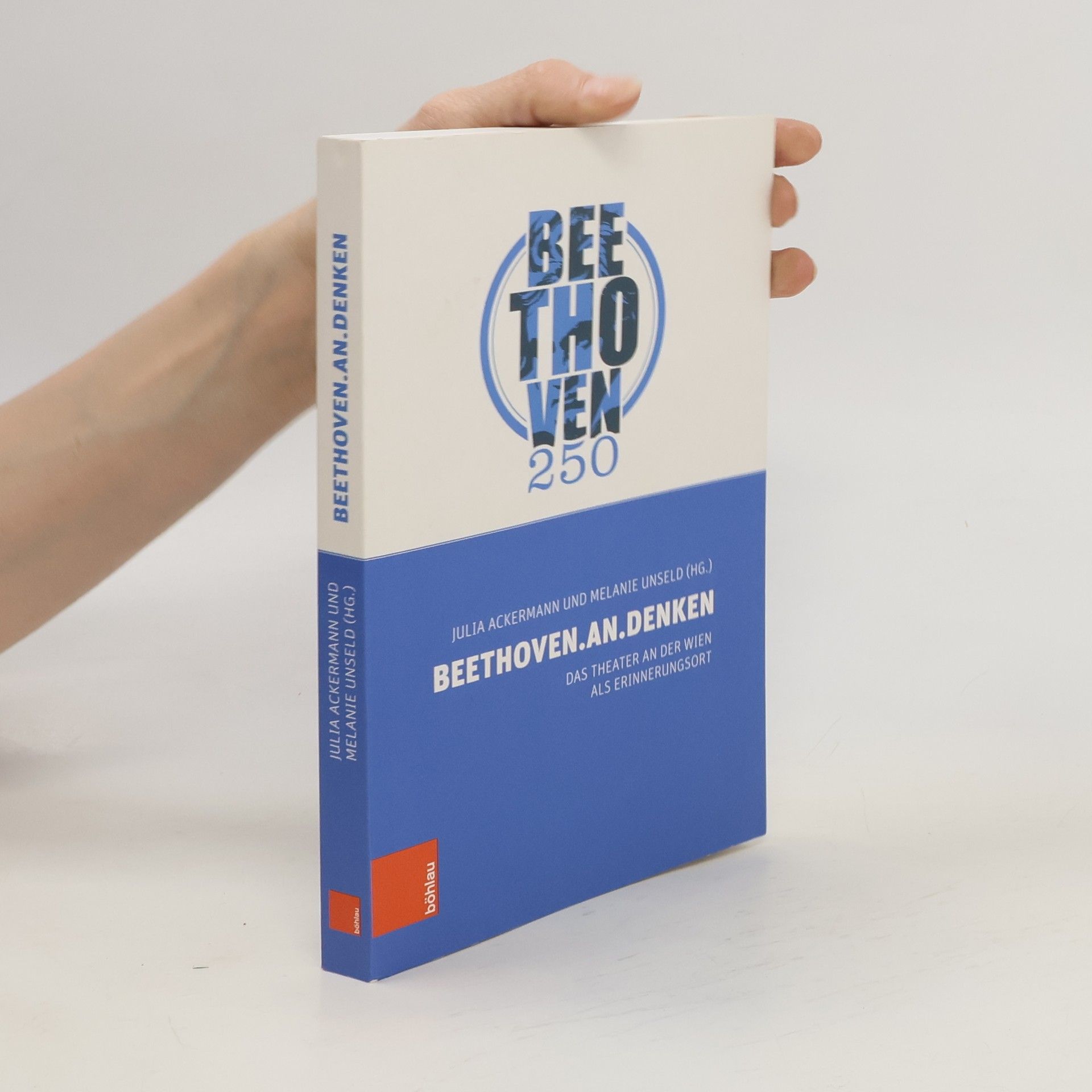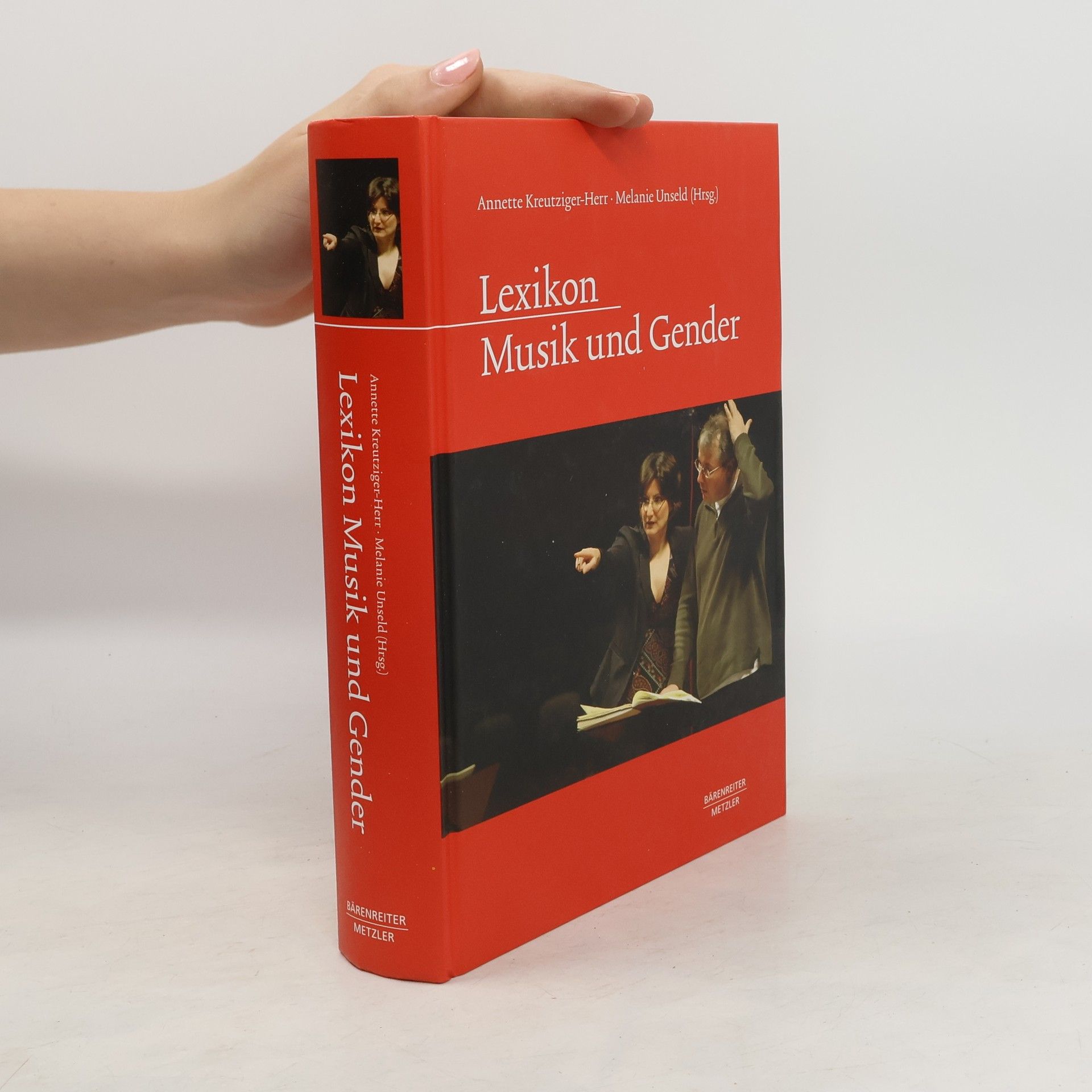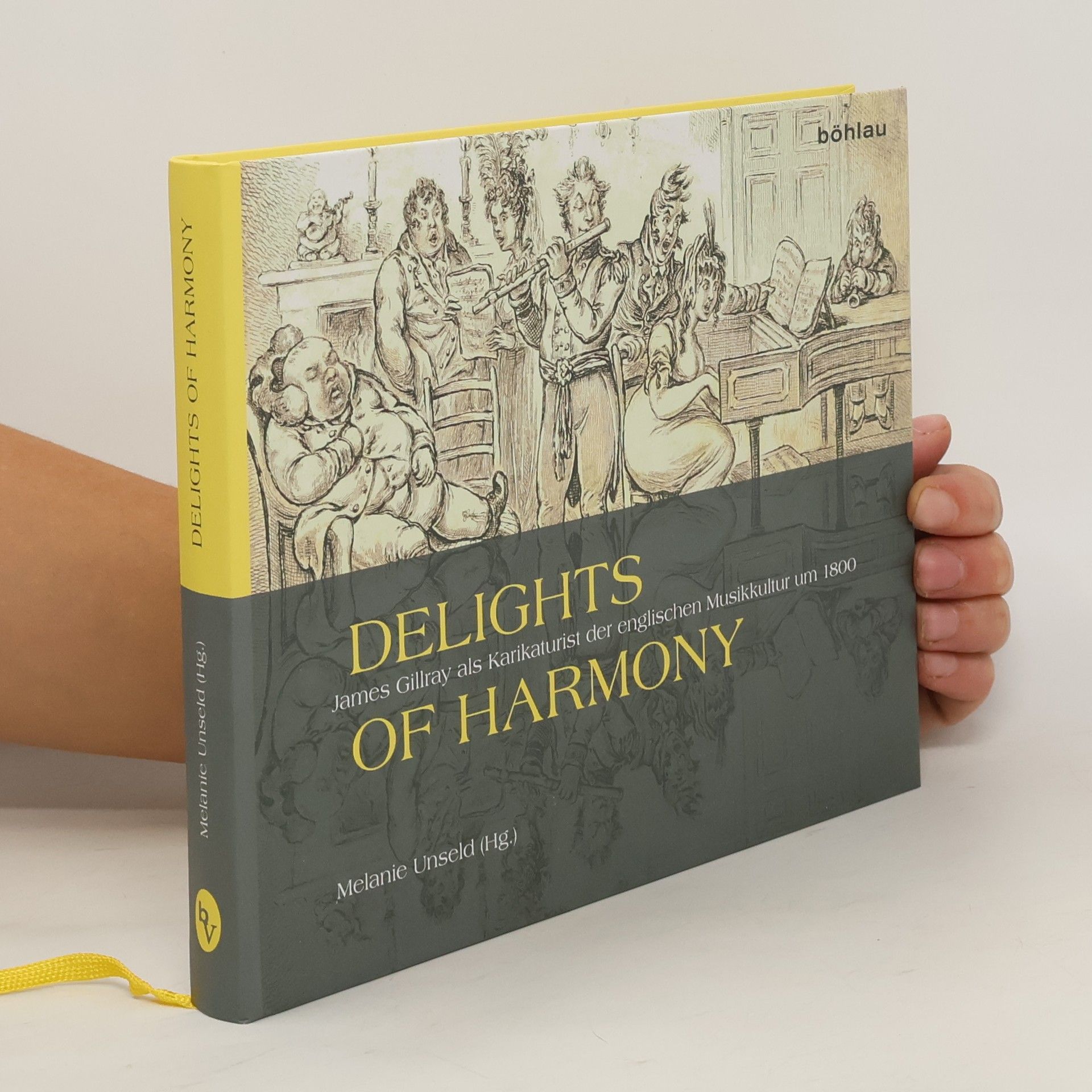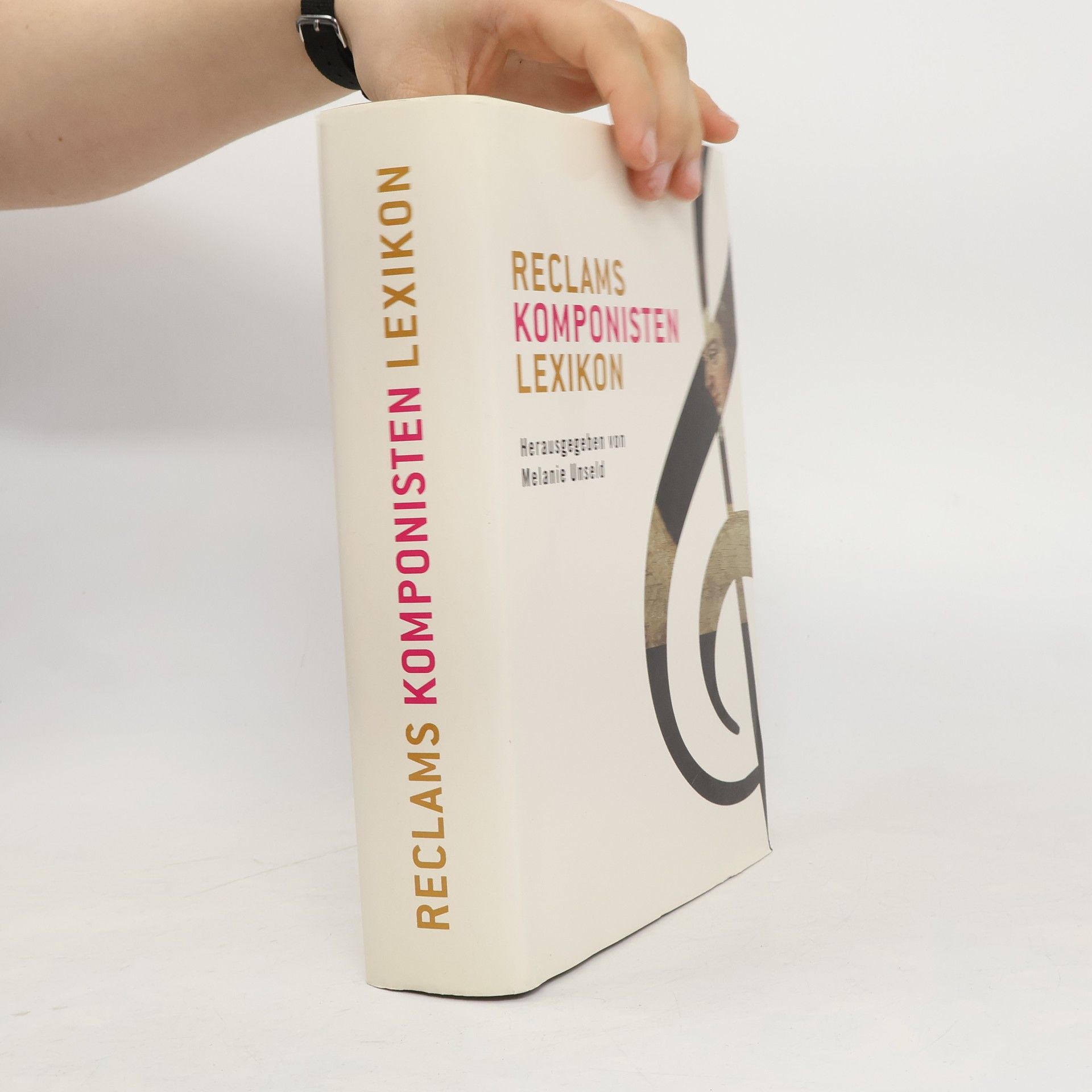Mozarts Frauen
- 189pages
- 7 heures de lecture
Melanie Unseld, 1971 geboren, studierte Musikwissenschaft, Literatur, Philosophie und Angewandte Kulturwissenschaften in Karlsruhe und Hamburg. Promotion 1999 („Man töte dieses Weib!“ Tod und Weiblichkeit in der Musik der Jahrhundertwende. Stuttgart 2001). 2002 bis 2004 Stipendiatin des Lise-Meitner-Hochschulsonderprogramms (Habilitation über musikalische Biografik). 2005-2008 war sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Seit 2008 ist sie Professorin für Kulturgeschichte der Musik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.