Matthias Steinbach Livres
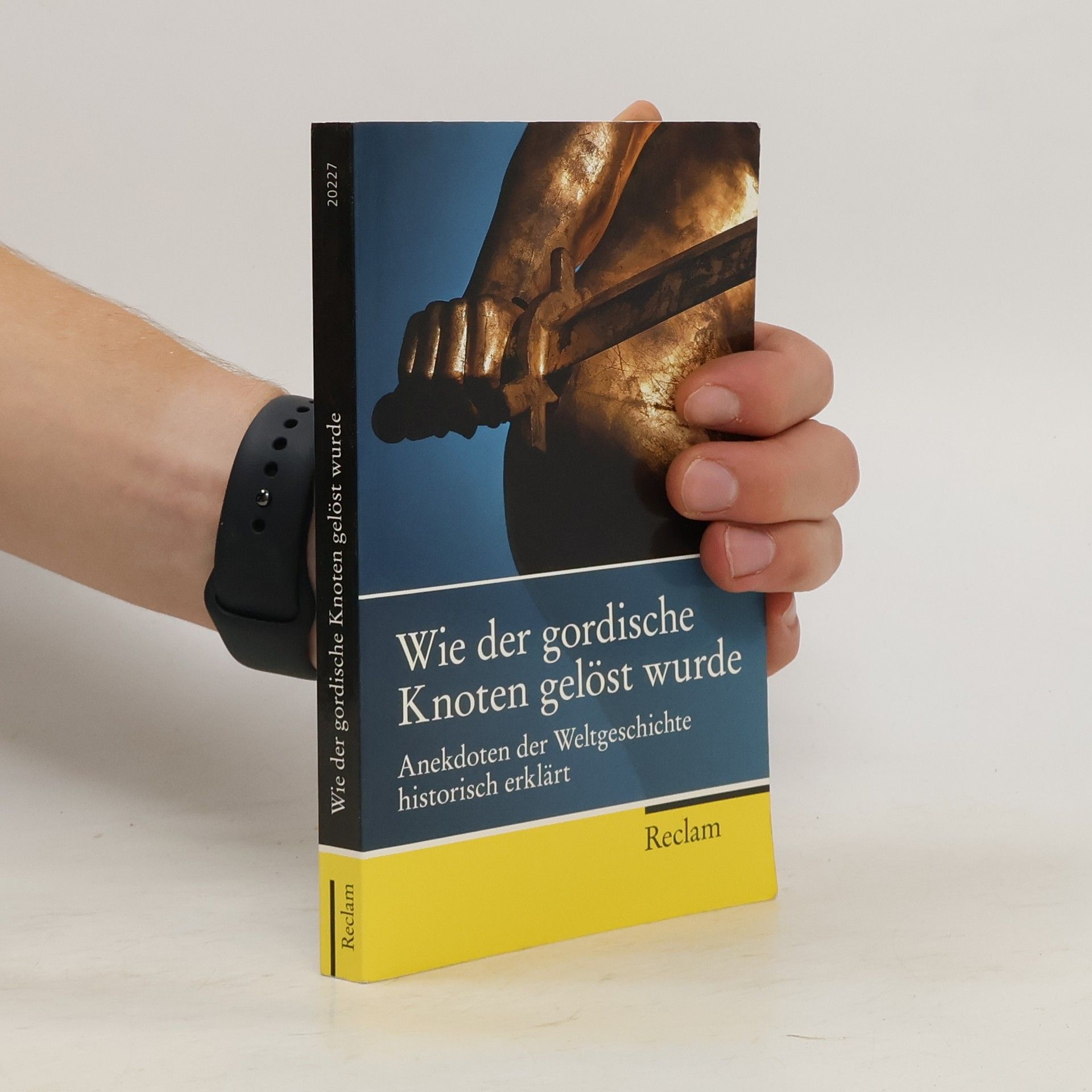
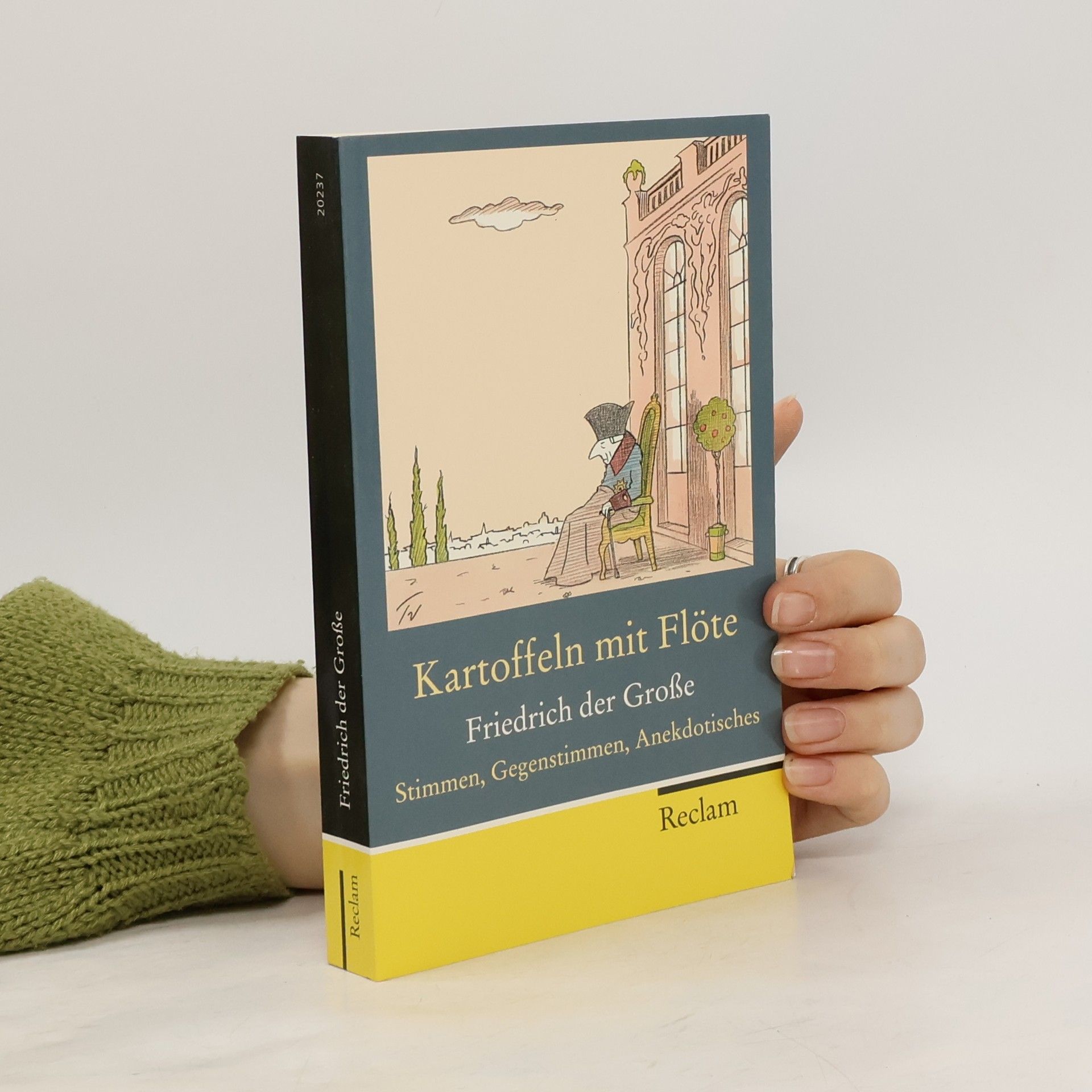
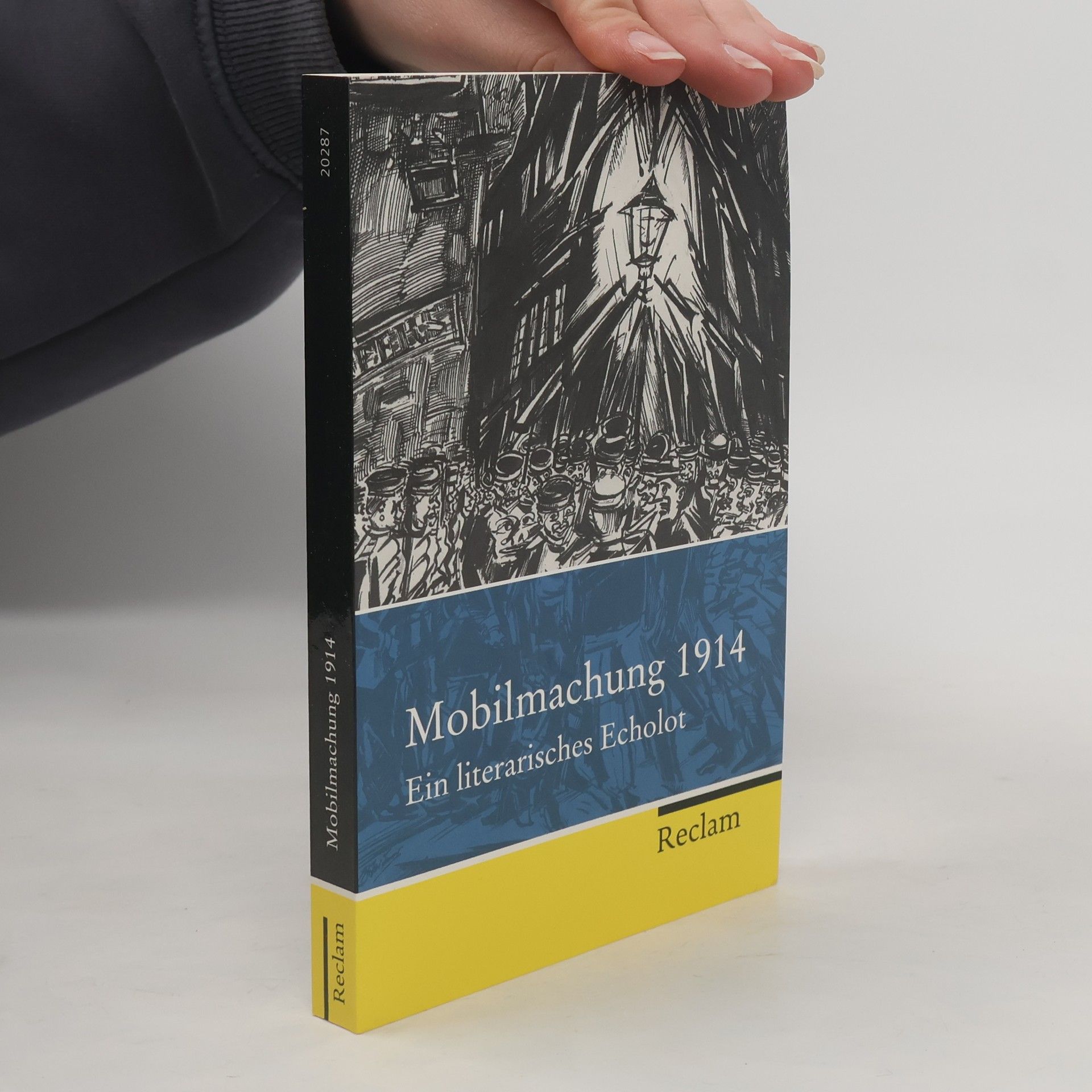


Wie Schneewittchen im Sarg liegt der steinerne Hindenburg in seiner Grube auf dem Kyffhäuser. Seit 1939 stand er neben Barbarossa und Wilhelm I. Die Geschichte des Denkmals erzählt vom nazistischen Hindenburg-Mythos und von Schwierigkeiten mit der Entsorgung deutscher Geschichte. 1947 auf Geheiß der Sowjetischen Militäradministration umgestürzt, wurde der Koloss 2004 wieder ausgegraben, jedoch nicht wieder aufgestellt. Matthias Steinbachs Geschichte des Verschwindens und Wiederauftauchens unternimmt einen Gang durch Landschaft und Literatur entlang des Berges. Es geht um Verschüttungen, Verdrängungen, Erfindungen und Überschreibungen. Die Leserschaft erfährt, wie sich die Geisterstimmen der Vergangenheit zu den Missverständnissen der Gegenwart verhalten.
Mobilmachung 1914
- 300pages
- 11 heures de lecture
»Es geht in den Krieg wie die Ente ins Wasser...« So beschrieb eine deutsche Diplomatengattin in London, was sie im August 1914 sah und hörte: wie nicht nur in Deutschland die Begeisterung über einen Anlass zum Krieg und die Überzeugung, ein solcher Krieg sei von nationalem Vorteil und gewinnbar, Überhand nahm – eine Kriegslüsternheit, die uns heute schier unbegreiflich ist. Diese vielstimmige Anthologie unternimmt es, den oft beschworenen »Geist von 1914« in seinen höchst unterschiedlichen Ausprägungsformen, die »Augusterlebnisse«, zu rekonstruieren, die seelische Atmosphäre zu Beginn und die brutale Ernüchterung, die folgte, aus autobiographischen Texten und literarischen Selbstzeugnissen zu charakterisieren.
Reclam huldigt Friedrich dem Großen nicht mit einer womöglich verehrungsvollen Biographie, sondern mit einem fröhlich vielgängigen Fritz-Menü samt vielstimmiger Tafelmusik. Denn über den Inbegriff historischer (nicht moralischer!) Größe bei faktischer Kleinheit (ein Meter fünfundsechzig) gibt es jede erdenkliche Meinung und Einschätzung und jeden diametralen Gegensatz: der zarte und früh gebrochene Jugendliche, der allgegenwärtige, alles und jedes kommentierende Landesvater, der eitle Feingeist und Philosoph, der alte kranke Mann am Krückstock, der populäre Schlachtenlenker des Siebenjährigen Kriegs, der »böse Mann« (so Maria Theresia). Überwölbt zudem von den weißen und schwarzen Preußenlegenden der Geschichtsschreibung von vorbildlichem Staat und räuberischem Militarismus. All dies wird in sowohl anekdotischer wie analytischer Form in fünf abwechslungsreichen Kapiteln versammelt, über den Kronprinz, den Feldherrn, den Philosoph, den Alten Fritz und die Nachwelt.
Der sagenumwobene gordische Knoten, der Herrschaft über ganz ›Asia‹, also Persien demjenigen versprach, der ihn löste, wurde von Alexander dem Großen, der natürlich um seine Bedeutung wusste, ganz einfach durchgehauen. Der Kern dieser wohl berühmtesten Anekdote der Weltgeschichte: Mit Gewalt geht alles schneller (kaputt). Historiker mögen diese Erzählform nicht unbedingt, aber sie können sie mit Gewinn nutzen zur Erhellung des Allgemeinen und des Hintergründigen hinter allen Fakten. Der vom Braunschweiger Historiker Matthias Steinbach zusammengestellte Band unternimmt genau dies: In kürzeren Essays werden allgegenwärtige Geschichtsanekdoten von Alexander dem Großen bis zu Helmut Kohl im Hinblick auf ihre mindestens doppelte Wahrheit erklärt und interpretiert.