Oliver Fahle Livres

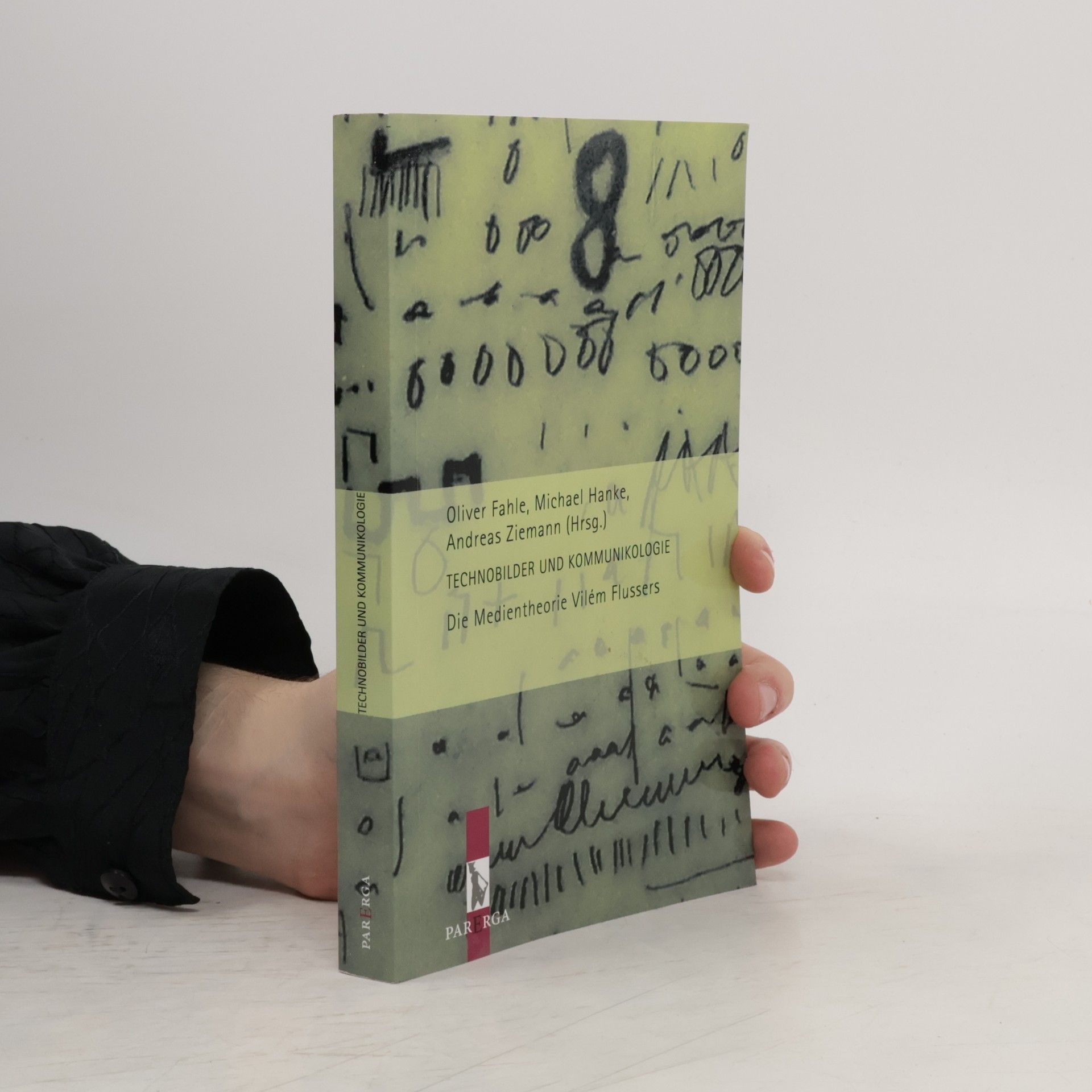
Theorien des Dokumentarfilms zur Einführung
- 264pages
- 10 heures de lecture
Im Kontext von "fake news" und der Verbreitung visueller Medien untersucht das Buch die Relevanz des Dokumentarischen für verschiedene Wissenschaftsbereiche. Oliver Fahle beleuchtet die Entwicklung und Theorien des Dokumentarfilms von den 1920er Jahren bis heute. Anhand historischer Beispiele werden zentrale Konzepte wie dokumentarische Wahrheit, Authentizität sowie das Verhältnis von Fakt und Fiktion analysiert. Die Auseinandersetzung mit diesen Begriffen zeigt deren Bedeutung in der heutigen Medienlandschaft und deren Einfluss auf Wissen und Vermittlung.