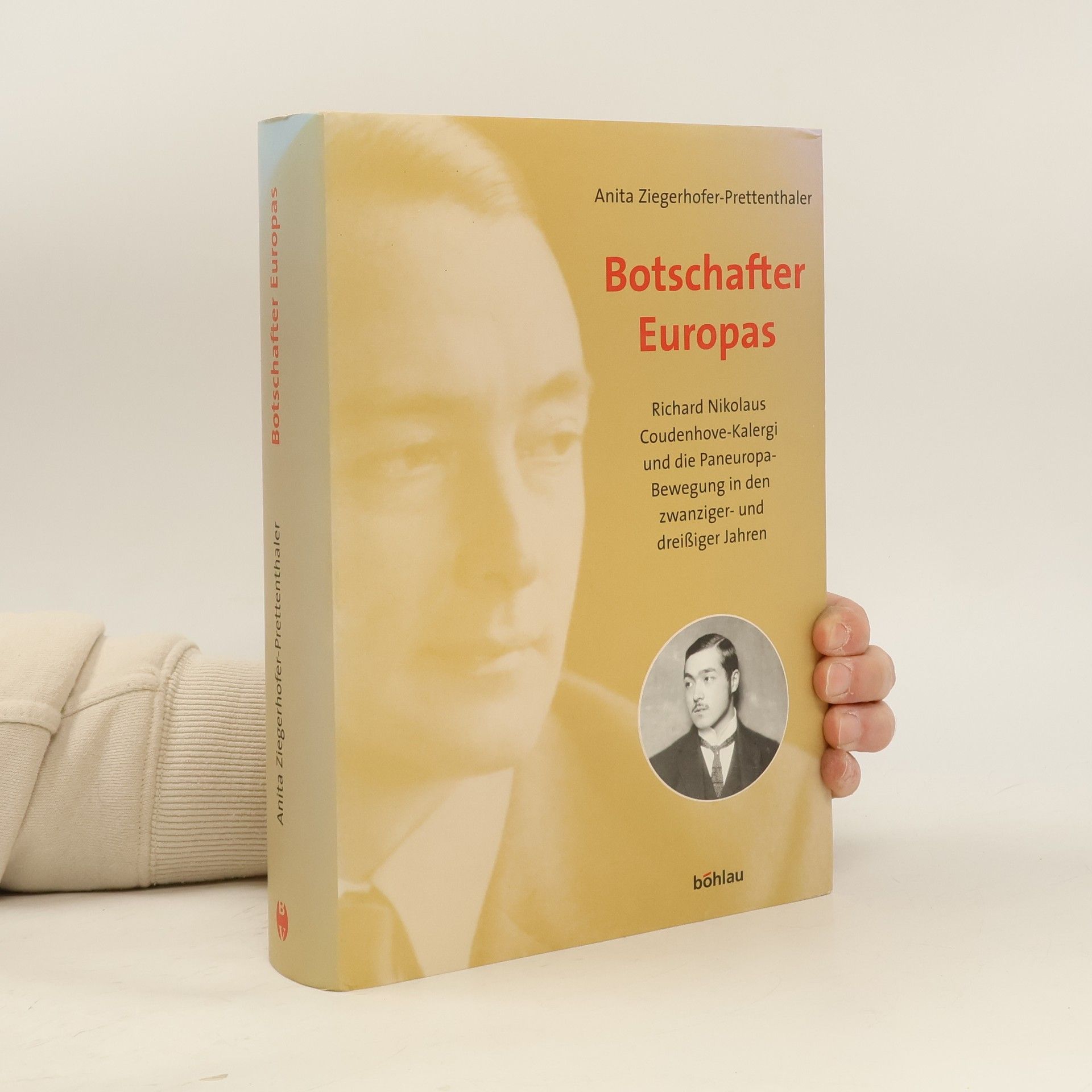Anita Ziegerhofer Livres
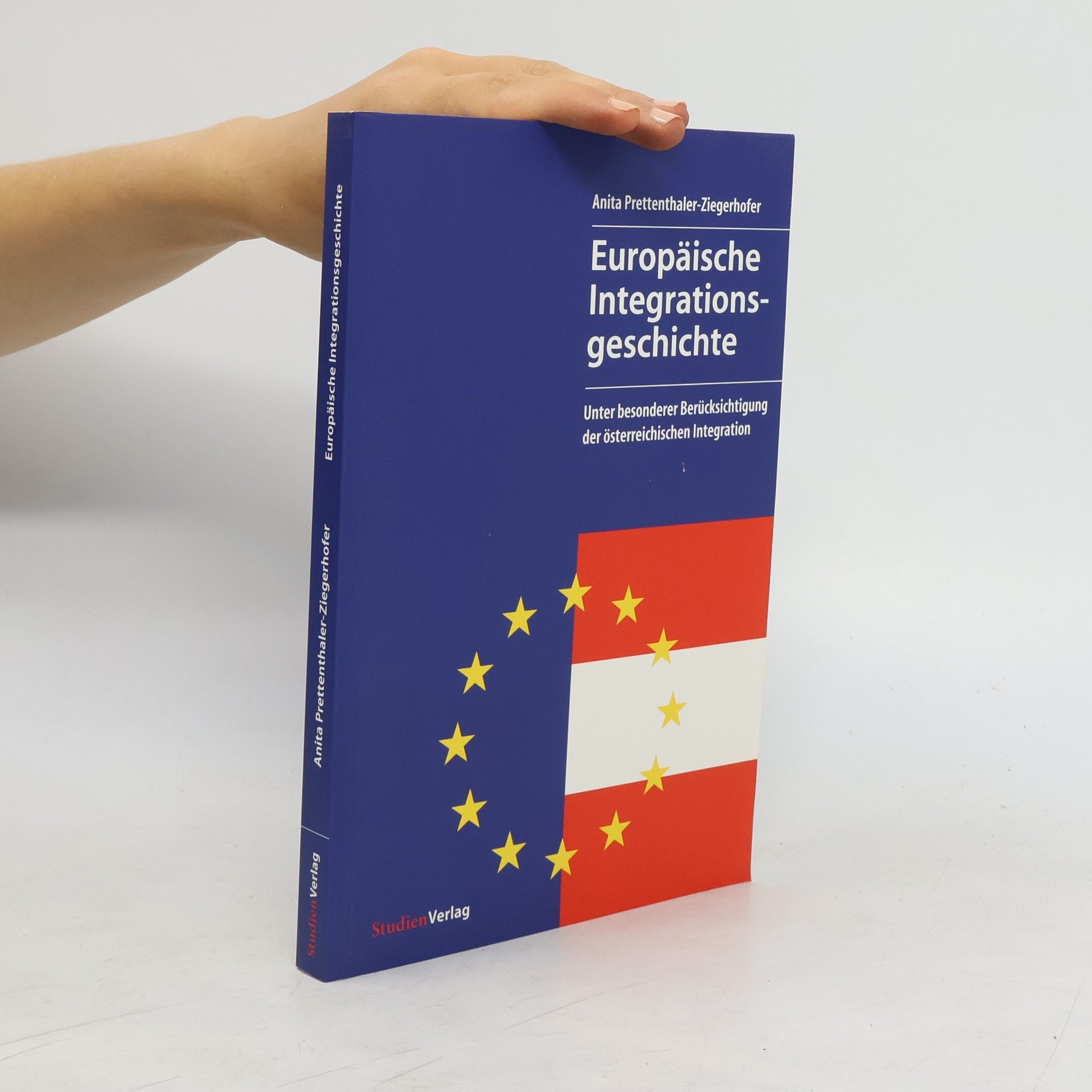
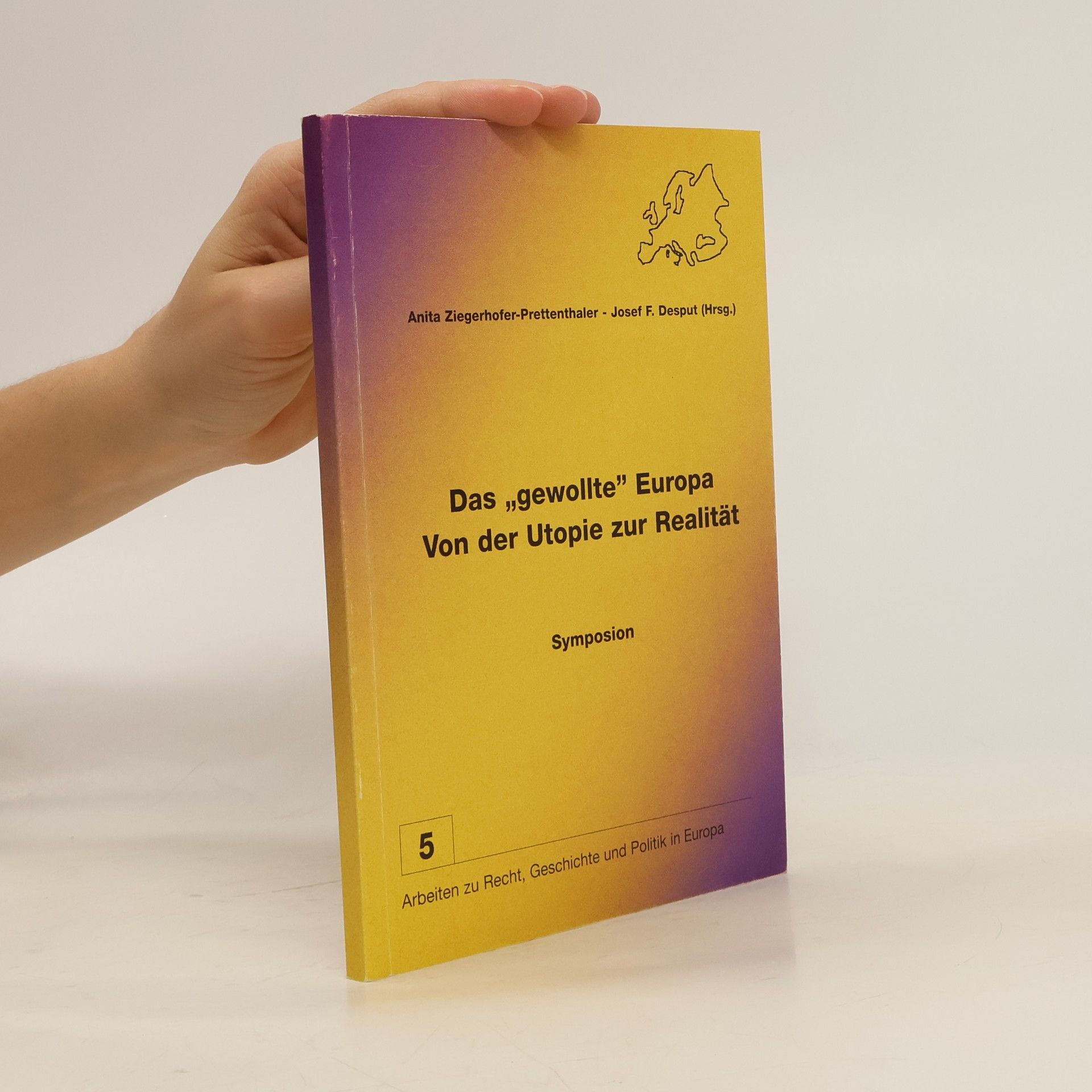
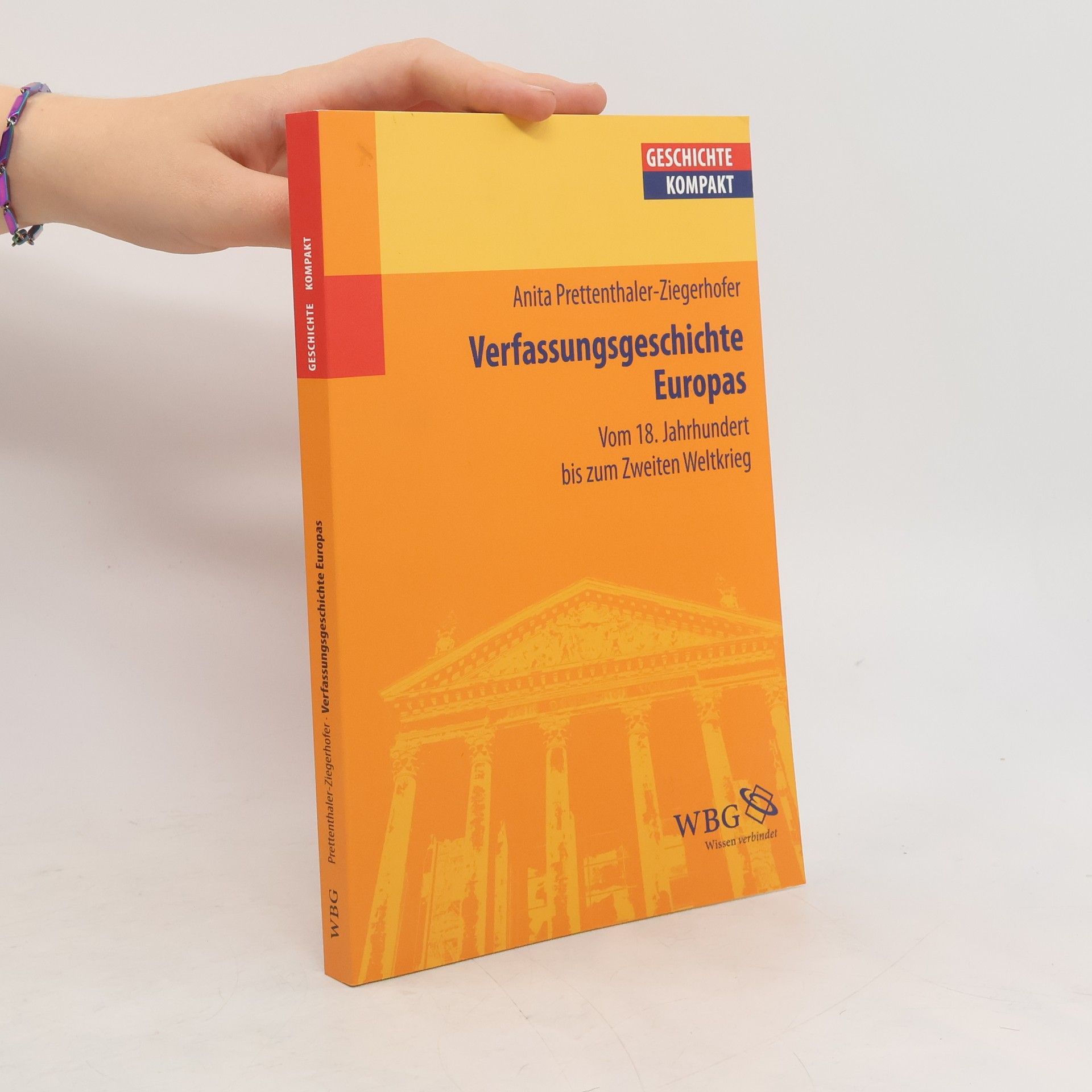



Verfassungsgeschichte Europas
Vom 18. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg
- 151pages
- 6 heures de lecture
Die Französische Revolution von 1789 war der Startschuss für die europaweite Forderung nach einer modernen Verfassung. In den Revolutionen des 19. Jahrhunderts war diese der entscheidende Streitpunkt, die Krisen des 20. Jahrhunderts führten zu radikalen Neuorientierungen in der Verfassungsfrage und die europäische Union stellt die Mitgliedsstaaten vor eine ganz neue Situation. So wird deutlich, dass die Verfassungsentwicklung nur gesamteuropäisch betrachtet werden kann, da jede neue Verfassung sich an anderen europäischen Vorbildern orientierte. Anita Prettenthaler-Ziegerhofer zeichnet die grundlegenden europäischen Verfassungsentwicklungen von 1789 bis heute nach. Sie beschreibt die richtungweisenden Verfassungen und ihren jeweiligen Einfluss auf andere Staaten. Darüber hinaus zeigt sie die Auswirkungen der Entwicklung auf den heutigen Stand des modernen Verfassungsstaates und auf die Bemühungen um eine gesamteuropäische Verfassung.
„Europa war über Jahrhunderte eine Idee, eine Hoffnung auf Frieden und Verständigung.“ Diese Worte der „Berliner Erklärung“ zum 50. Geburtstag der Europäischen Union verweisen auf die fast 700-jährige Tradition der Europa-Idee, die den ewigen Frieden für den Kontinent anstrebt, jedoch oft nur Visionen blieben. Der Erste Weltkrieg legte den Grundstein für einen Paradigmenwechsel, der durch die Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg vollzogen wurde. Ihre Ideen von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit führten zur Schaffung eines „neuen Europas“ und zur Überwindung des Nationalismus durch die Übertragung von Souveränität an supranationale Organisationen. Ab 1945 begann die europäische Integration, die von Krisen und nationalem Denken begleitet wurde. Das Buch bietet einen Rückblick auf die Europa-Pläne ab dem 14. Jahrhundert, mit einem Fokus auf den Integrationsprozess nach 1945 und die Rolle europäischer Institutionen wie des Europarats. Es behandelt die Geschichte dieser Institutionen, Grundrechte, Gender Gemeinschaftsrecht, Erweiterung und Österreichs Weg nach Brüssel. Die 2007 überarbeitete Neuausgabe berücksichtigt die Entwicklungen der EU und die fortschreitende Forschung. Zahlreiche Dokumente und Grafiken ergänzen die Darstellungen und machen das Werk zu einem unverzichtbaren Nachschlagewerk für Europainteressierte. Die Autorin ist ao. Univ.-Prof. Dr. Anita Prettenthaler-Ziegerhofer, Historikerin mit umfangr
Im Jahr 1923 gab Richard Coudenhove Paneuropa als Parole gegen die drohende „wirtschaftliche Gefahr“ aus den USA und gegen die „bolschewistische Gefahr“ aus dem Osten aus. Sein Charisma und vor allem sein Optimismus waren für ihn das Entree in die höchsten Regierungskreise Europas, zu den Wirtschaftstreibenden und Intellektuellen. Obwohl es Coudenhove nicht gelang, Paneuropa politisch, wirtschaftlich oder kulturell zu etablieren, überlebten die Ideen des Visionärs und Idealisten den Zweiten Weltkrieg und sind teilweise in der Europäischen Union aufgegangen. Basierend auf dem Aktenbestand des Moskauer Archivs bietet der Band eine erste Gesamtdarstellung des Menschen Coudenhove-Kalergi und der Paneuropa-Bewegung, liefert Informationen, verifiziert und falsifiziert Meinungen über Coudenhove und seine Bewegung und bietet eine Reihe von Anknüpfungspunkten für weitere Forschungen.