Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit
- 218pages
- 8 heures de lecture
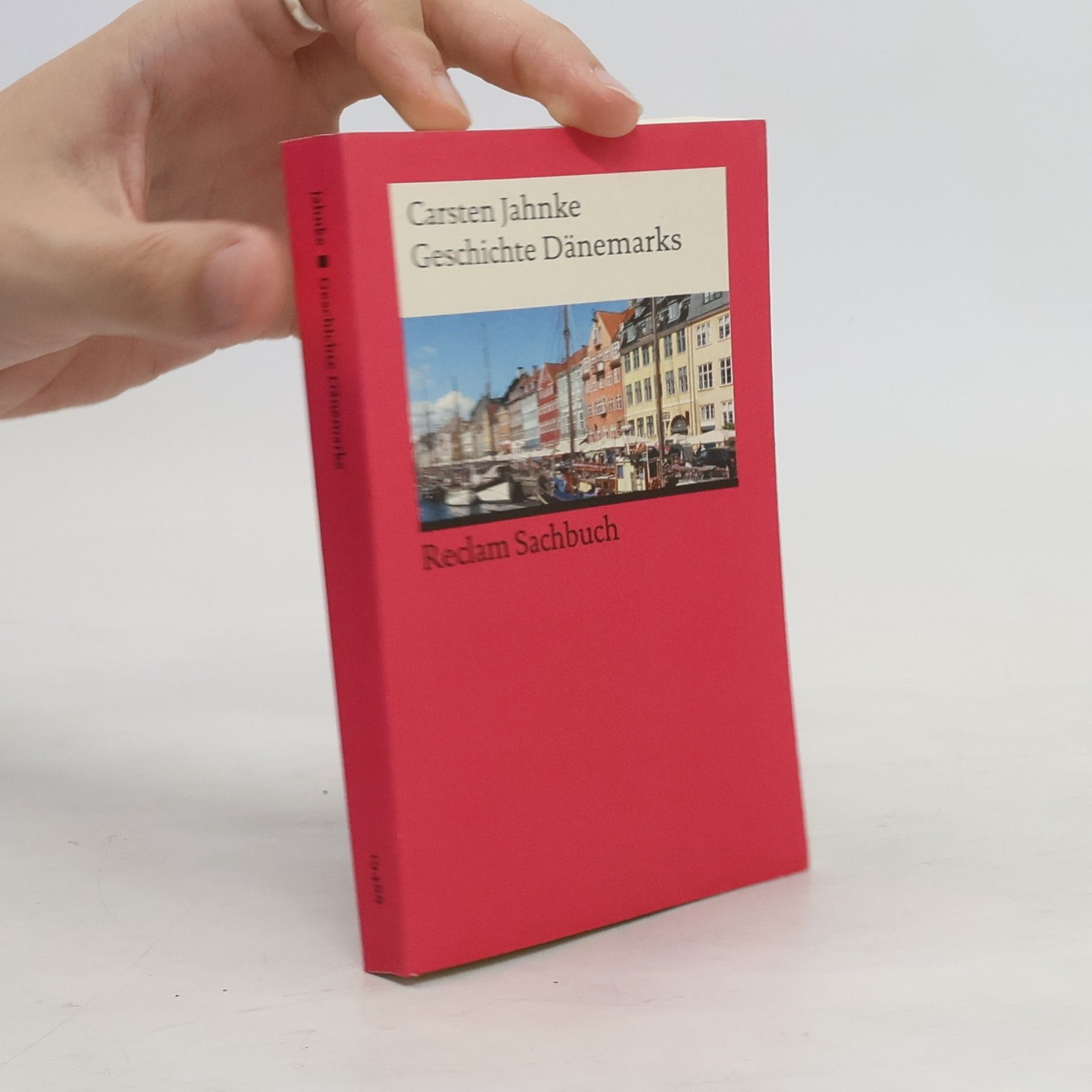
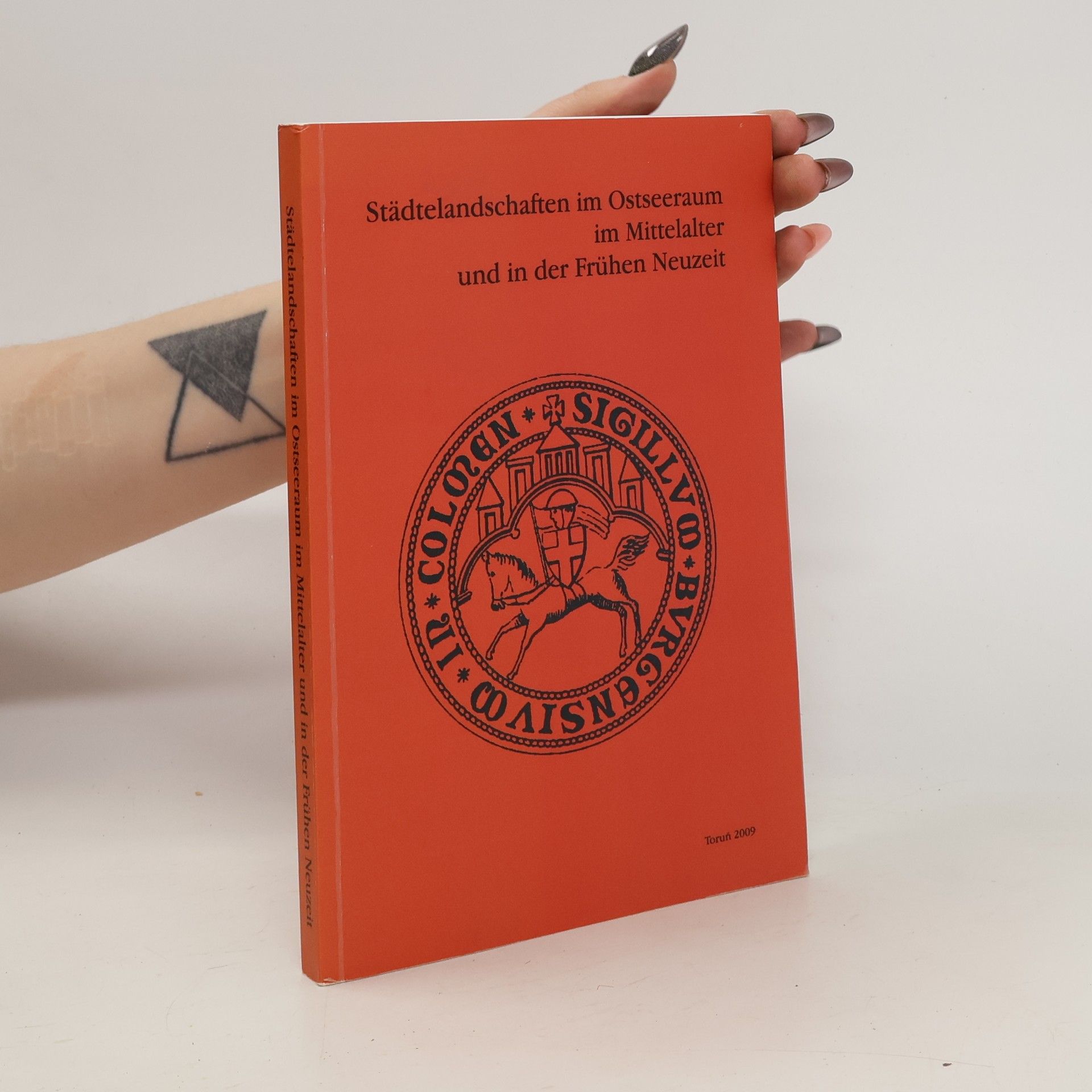
Die meisten Deutschen kennen Dänemark vor allem als Ferienland. Dabei hat das Königreich zwischen Nord- und Ostsee eine äußerst bewegte Geschichte. Zur Zeit der Wikinger reichte das Herrschaftsgebiet bis nach England, in der Frühen Neuzeit rangen die Dänen mit ihren Nachbarn um die Vorherrschaft in der Ostsee, im 19. Jahrhundert ist der Kampf um Schleswig(-Holstein) ein Wendepunkt auch der deutschen Geschichte, im 20. Jahrhundert waren die Dänen zusammen mit ihren nordischen Nachbarn Vorreiter in Sachen Sozialstaat. Es gibt also viel zu erzählen. Carsten Jahnke tut es in seinem Überblick über die Geschichte unseres kleinen, geschichtsträchtigen Nachbarn von der ersten Besiedlung bis in die Gegenwart.