Diese Publikation behandelt umfassend den Vermögensentzug, die Rolle der Profiteure und die Praxis der Rückstellungen im Bereich der katholischen Kirche in Österreich. Das dichte Netz von Einrichtungen der katholischen Kirche und ihre tiefe Verankerung in der Gesellschaft standen in Konkurrenz zu den Zielen der NS-Herrschaft, die totale Kontrolle über die Menschen anstrebte. Die adaptive Haltung der katholischen Kirchenführung zur nationalsozialistischen Machtübernahme hinderte das Regime nicht, das Verhältnis von Kirche und Staat grundlegend zu verändern. Im Vordergrund stand die Ausschaltung des kirchlichen Einflusses auf das Bildungswesen und der Zugriff auf die Vermögenswerte der katholischen Kirche. Das NS-Regime nutzte die Auffassung, dass das Konkordat des Vatikans mit Österreich nicht mehr galt, wodurch ein konkordatsfreier Raum entstand. Die Umgestaltung der katholischen Kirchenfinanzen führte zu einem Systemwechsel, wodurch der Kirche erhebliche Mittel entzogen wurden, insbesondere der 1782 geschaffene Religionsfonds. Der größte Profiteur des Vermögensentzugs war die öffentliche Hand. Nach dem Ende der NS-Herrschaft veränderten sich die Rahmenbedingungen im Verhältnis von Kirche und Staat allmählich. Die Diskussion um das Konkordat belastete jedoch das Verhältnis über viele Jahre. Erst 1957 erkannte Österreich das Konkordat im Grundsatz an. 1959 erfasste die katholische Kirche die Schäden, die auf etwa 12 Mrd. öS ges
Irene Bandhauer-Schöffmann Livres
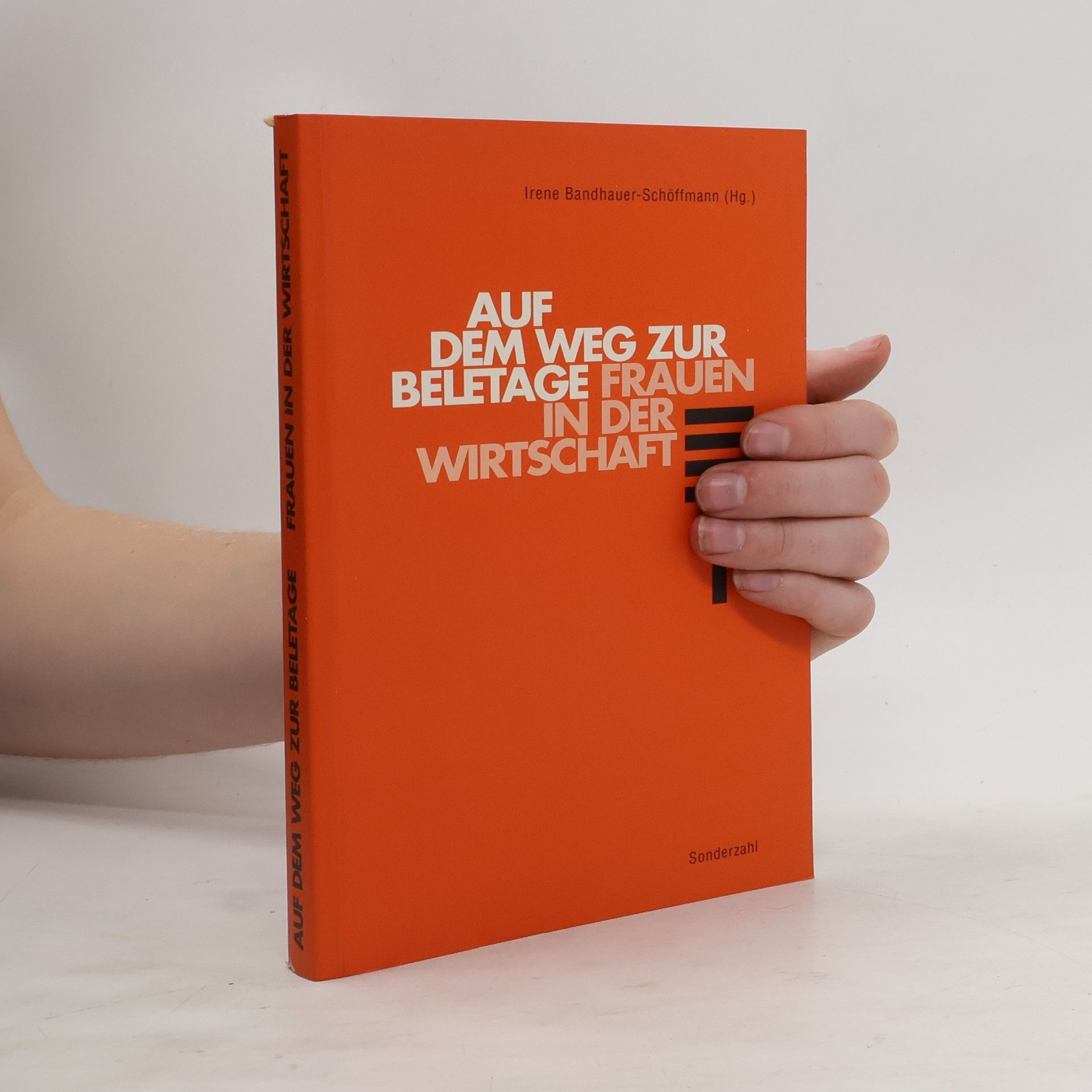
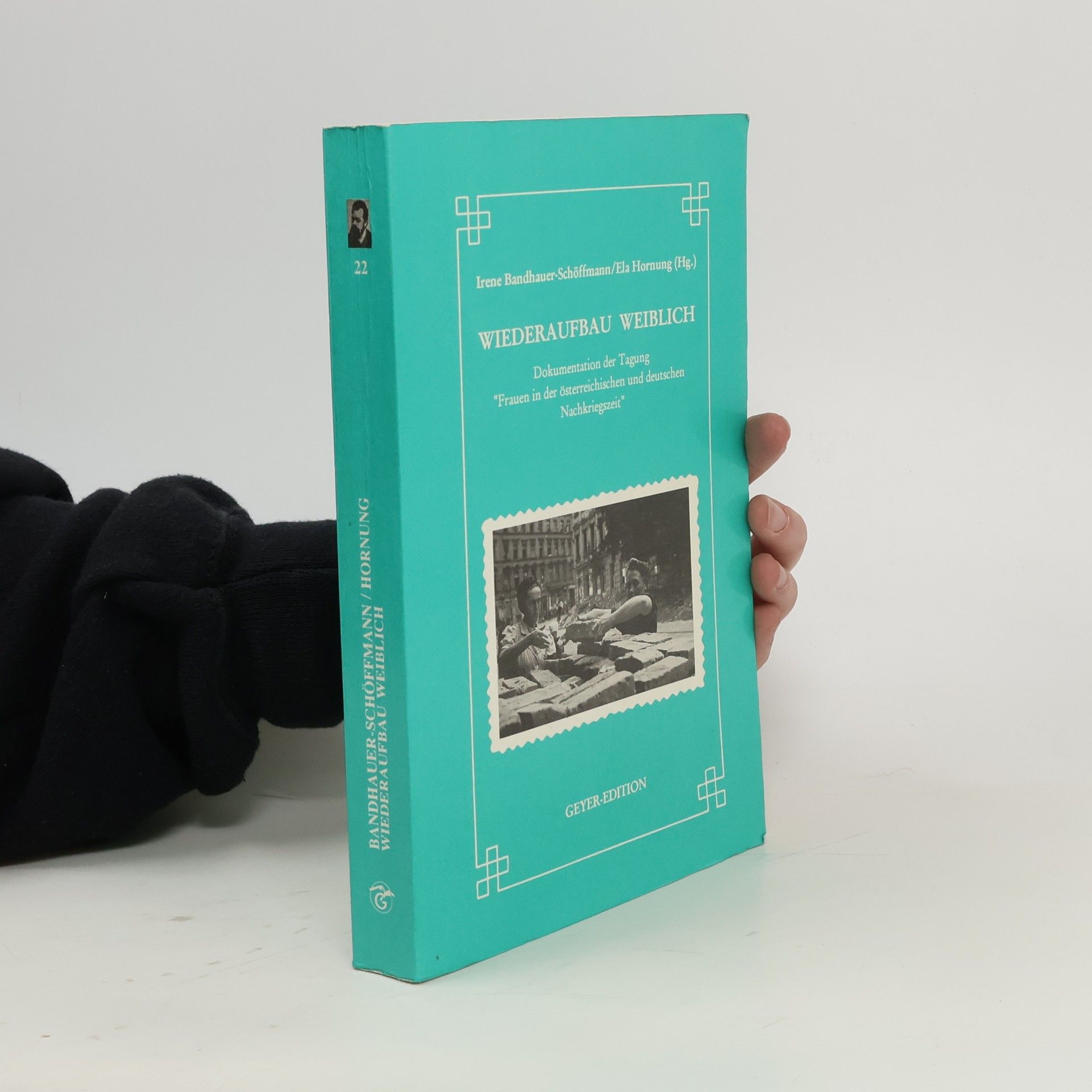

Auf dem Weg zur Beletage
- 231pages
- 9 heures de lecture