Die Sprache hat, vor allem in den letzten Jahrzehnten, schlimme Entwicklungen genommen, die man weitgehend als Schwächung oder als Verschmutzung bezeichnen kann, ersteres vor allem in der Grammatik (z. B. Viele würden die Gefahr leider noch unterschätzen), letzteres vor allem im Wortgebrauch (z. B. schwul oder die Menschen bei den Reformen mitnehmen). [Zur Wortschatzverschlechterung gehört auch die Fremdwörterei, die graecolateinische und mehr noch die englische.] Der Verfasser stellt den verdorbenen Sprachgebrauch an den Pranger und zeigt zugleich, daß man sich davon freihalten kann; darüber hinaus, daß auch Sprachbereicherung möglich ist. – Im Anhang wird die Rechtschreib„reform“ zerpflückt.
Johannes Dornseiff Livres
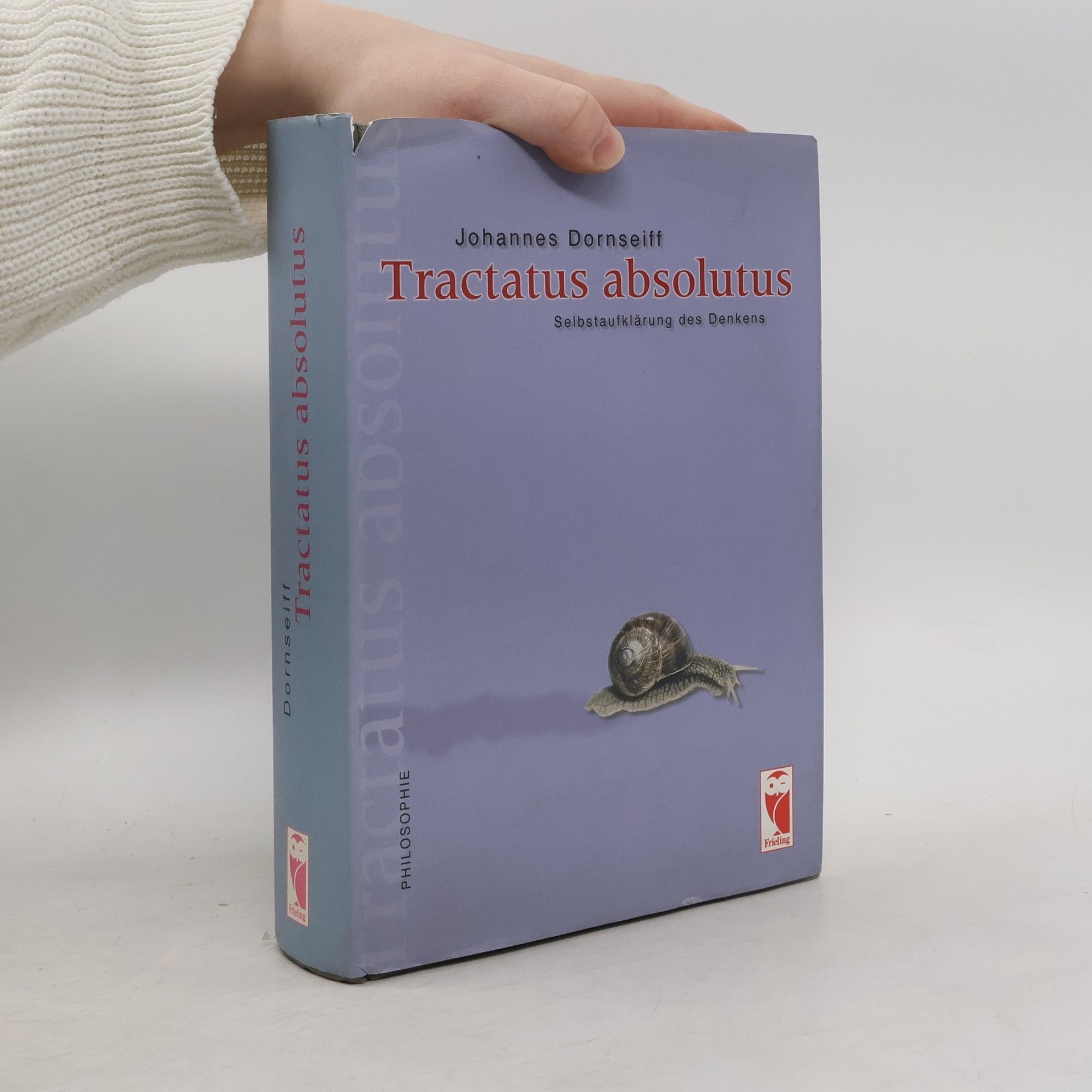
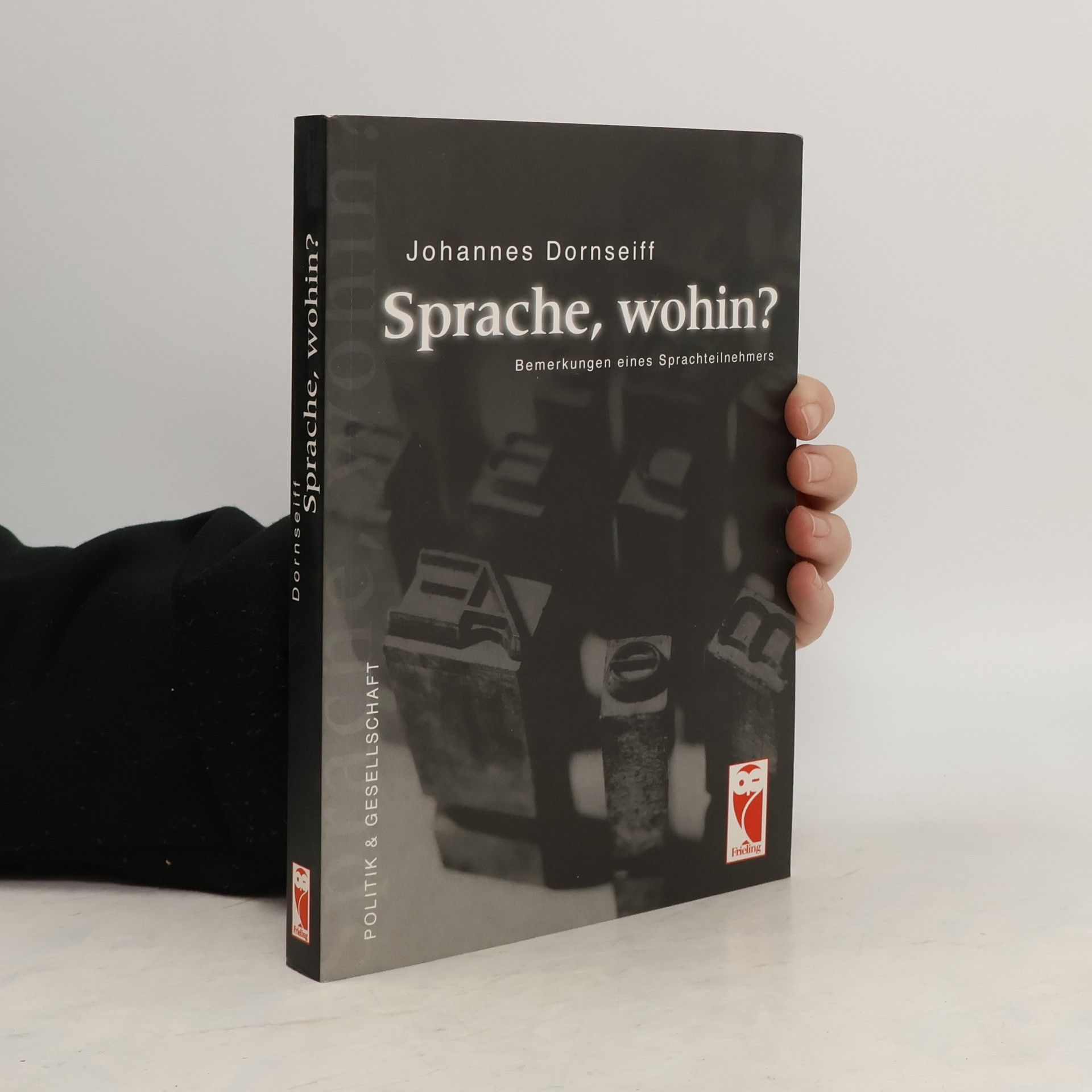
Tractatus absolutus
Selbstaufklärung des Denkens