Stefan Willer Livres

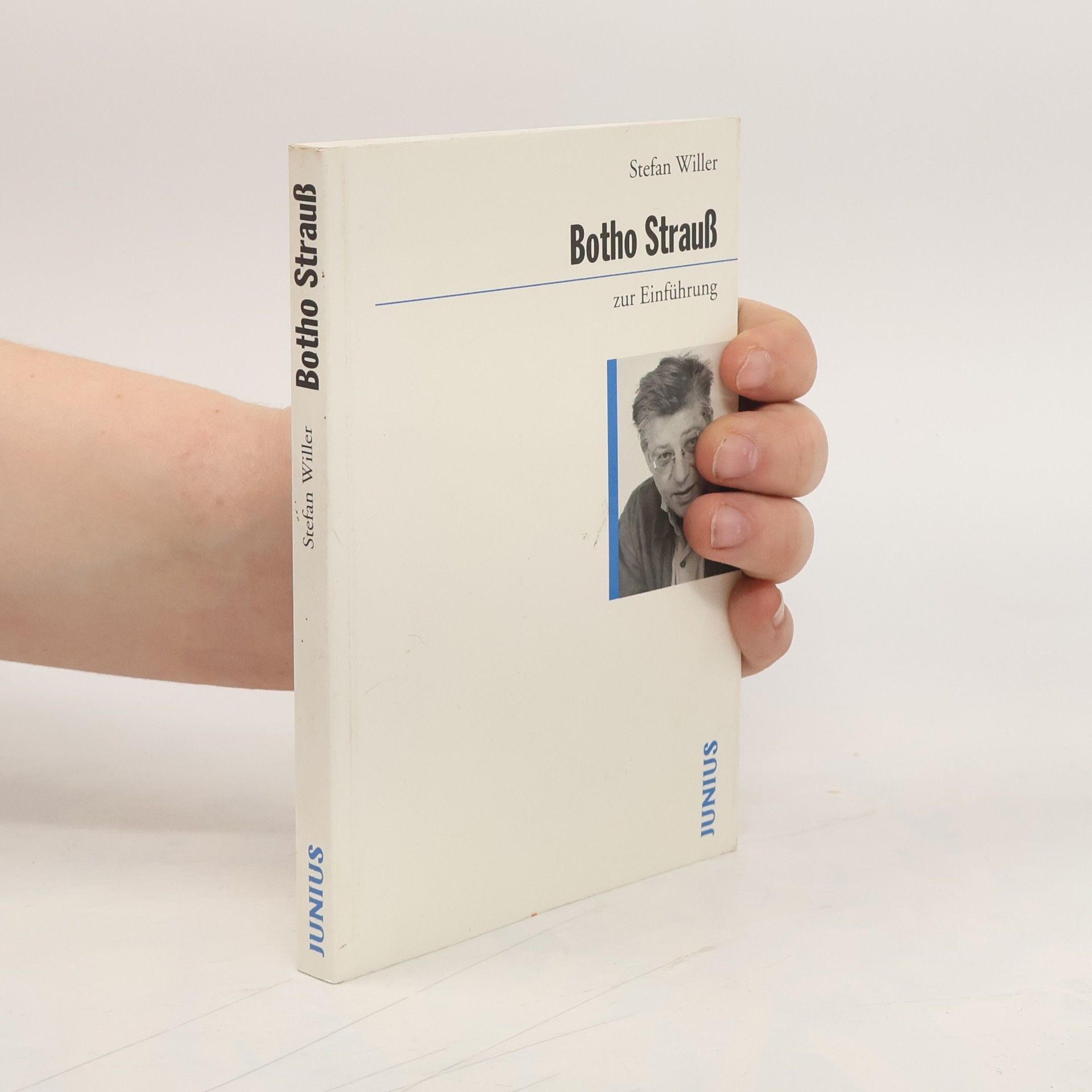


Wenn man vom Erbe spricht, kann die Erbschaft gemeint sein, der tradierte Kanon von Kulturgütern oder die biologische Vererbung. In allen Fällen geht es um Übertragungen von Generation zu Generation, bei denen Kontinuität und Veränderung in einem spannungsvollen Verhältnis stehen. Die Kapitel des Buches untersuchen wichtige Stationen der Kultur-, Rechts-, Religions- und Wissensgeschichte des Erbes vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Im Zentrum steht die Zäsur zwischen Vormoderne und Moderne. Damit erhält das aktuelle Interesse am Erbe eine historische Tiefenschärfe: Welche Verwandtschaftsmodelle liegen dem modernen Erbrecht zugrunde? Warum meint man, dass zukünftige Generationen an dem interessiert sein werden, was jeweils als kulturelles Erbe definiert wird? Und wie ist angesichts neuer Entwicklungen der Epigenetik der kulturelle Anteil an der biologischen Vererbung zu bestimmen?
Trajekte: Erbfälle
Theorie und Praxis kultureller Übertragung in der Moderne
- 397pages
- 14 heures de lecture
Das Erbe ist ein unabdingbares und zugleich unabgegoltenes Problem der Moderne. Stefan Willer untersucht die Wissensgeschichte moderner Erbekonzepte zwischen Recht, Biologie und Kultur und rekonstruiert einzelne literarhistorische Erbfälle zwischen 1889 und 1949. Erbe und Moderne - diese Verknüpfung ist so naheliegend wie widersprüchlich. Naheliegend ist sie mit Blick auf die neuere Kultur- und Wissenschaftsgeschichte, handelt es sich doch beim Erbe um einen Schlüsselbegriff zur Bestimmung von Eigentum, Eigenschaften und Eigenheiten im Spannungsfeld von Recht, Biologie und Politik. Widersprüchlich erscheint die Konjunktion zwischen Erbe und Moderne hingegen angesichts der Tendenzen zur Bewahrung, Stabilisierung und Kontinuitätsstiftung, die immer dort ins Spiel kommen, wo etwas bereits Bestehendes aus der Vergangenheit in die Zukunft transferiert werden soll.