Mao, Marx und Jesus.
Ein Vergleich in Zitaten
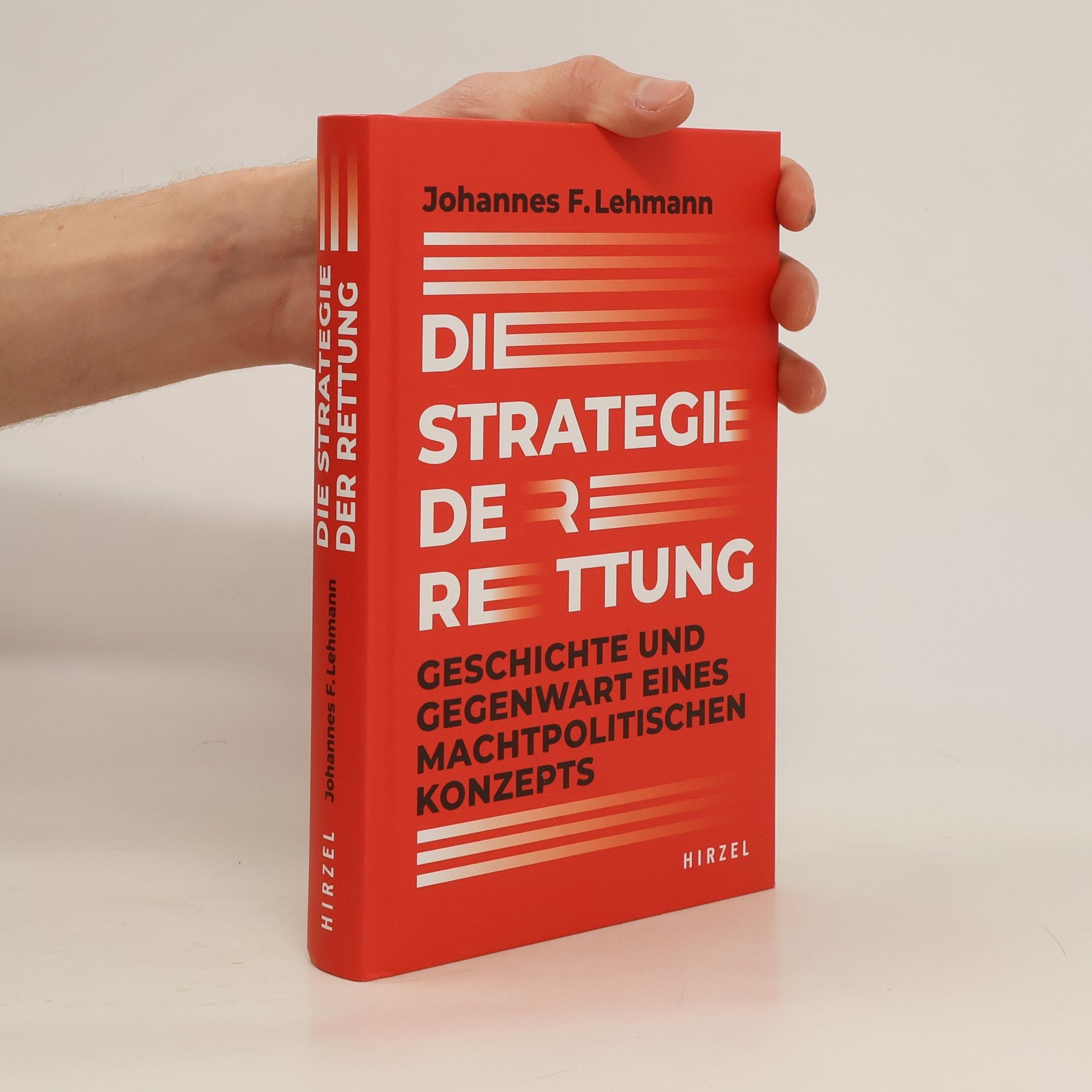

Ein Vergleich in Zitaten
Geschichte und Gegenwart eines machtpolitischen Konzepts
Rettung hat zwei grundverschiedene existentielle Dimensionen. Die eine zielt auf die Rettung einzelner Leben in Gefahr: Feuerwehrleute also retten Menschen aus Branden, Seenotretter etwa retten Schiffbruchige aus dem Mittelmeer, Notarzte retten Herzinfarktpatienten und Polizisten retten die entfuhrte Geisel. Die zweite Dimension der Rettung wiederum betrifft Systeme oder Segmente eines Gesamtsystems - denken wir nur einmal an die Banken-, Euro- oder Klimakatastrophenrettung - und verweist damit auf einen grosseren Zusammenhang, der uberhaupt erst die Voraussetzungen dafur schafft, dass Leben uberhaupt moglich ist oder jedenfalls bewahrt wird. Und, wir erleben das im gegenwartigen Russlandkrieg gegen die Ukraine ganz unabweisbar, selbst Waffen helfen verruckterweise auch Leben zu retten. Wie sehr nun gerade Politik Rettungsversuche ermoglicht oder verhindert, wie sehr sie ihr Handeln selbst als Rettungshandeln versteht und wie entschieden das Narrativ, also die Rede von Rettung schliesslich unser ganzes Politikverstandnis dominiert, das ist der komplexe Gegenstand dieses stringenten Essays. Uber die konkrete diskurs- und sozialgeschichtliche Ebene eines institutionalisierten Rettungswesens und dessen Verknupfung mit Macht, Recht und Okonomie hinaus, zielt Johannes F. Lehmanns Frage nach "Rettung" und "Erlosung" auf ein Erzahlmuster und ein Deutungsschema, das tief in der Kulturgeschichte des Abendlandes begrundet ist.