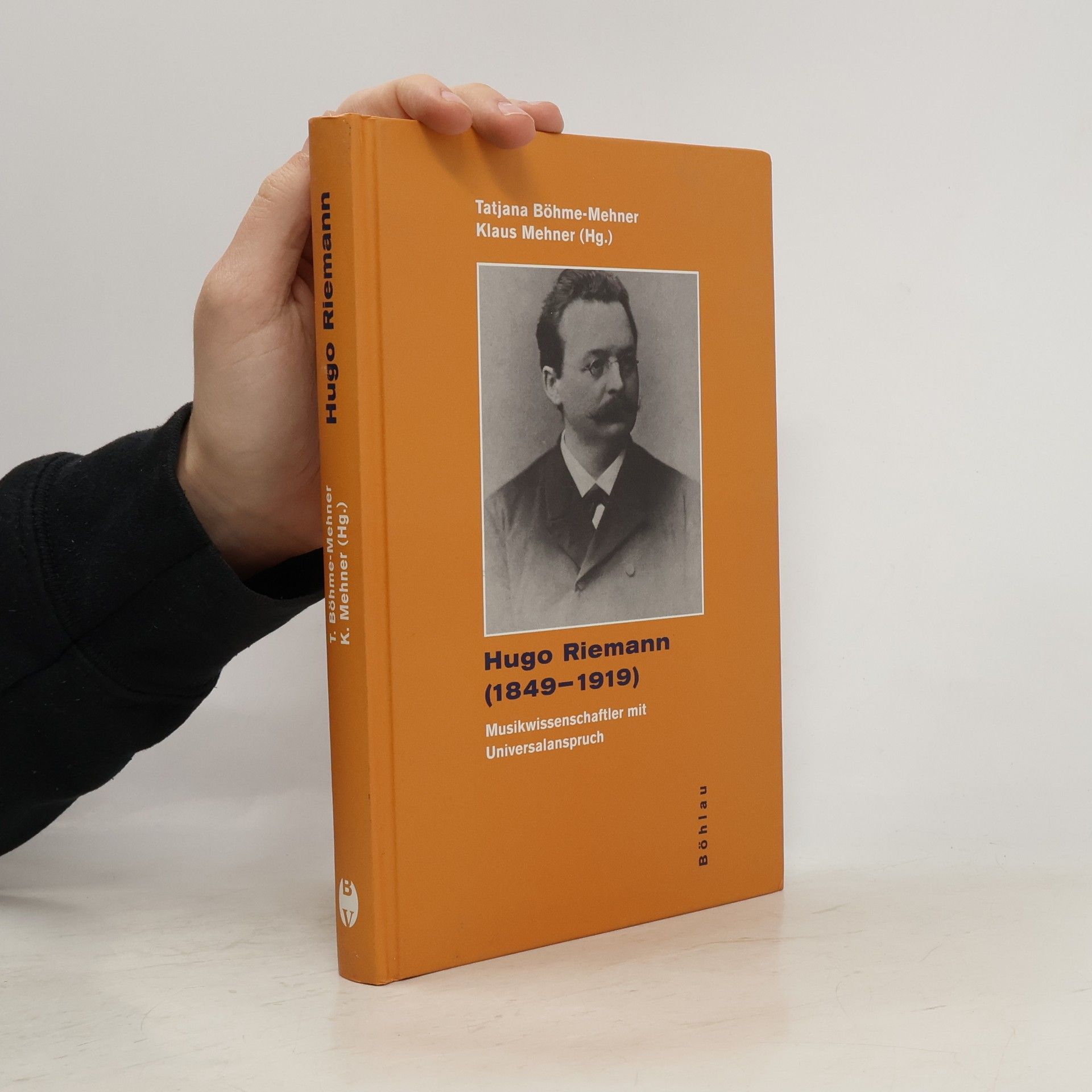Leipziger Mörderquartett
Kriminalroman
Eigentlich ist Anna Schneider gern Musikkritikerin in Leipzig, nur manchmal träumt sie von der großen Enthüllungsgeschichte, auch in der Hoffnung auf mehr Respekt und Anerkennung von den Kollegen. Da kommt ihr der Tod eines Streichquartettmitglieds während eines Konzerts gerade recht, genau wie die absurde Begegnung mit dem Gewandhaus-Bratscher Habakuk C. Brausewind, der fortan ihr Co-Ermittler ist. Die beiden durchpflügen den musikstädtischen Sumpf und bekommen es mit einem ominösen Instrumentenhändler zu tun. Steckt er hinter dem Mord?