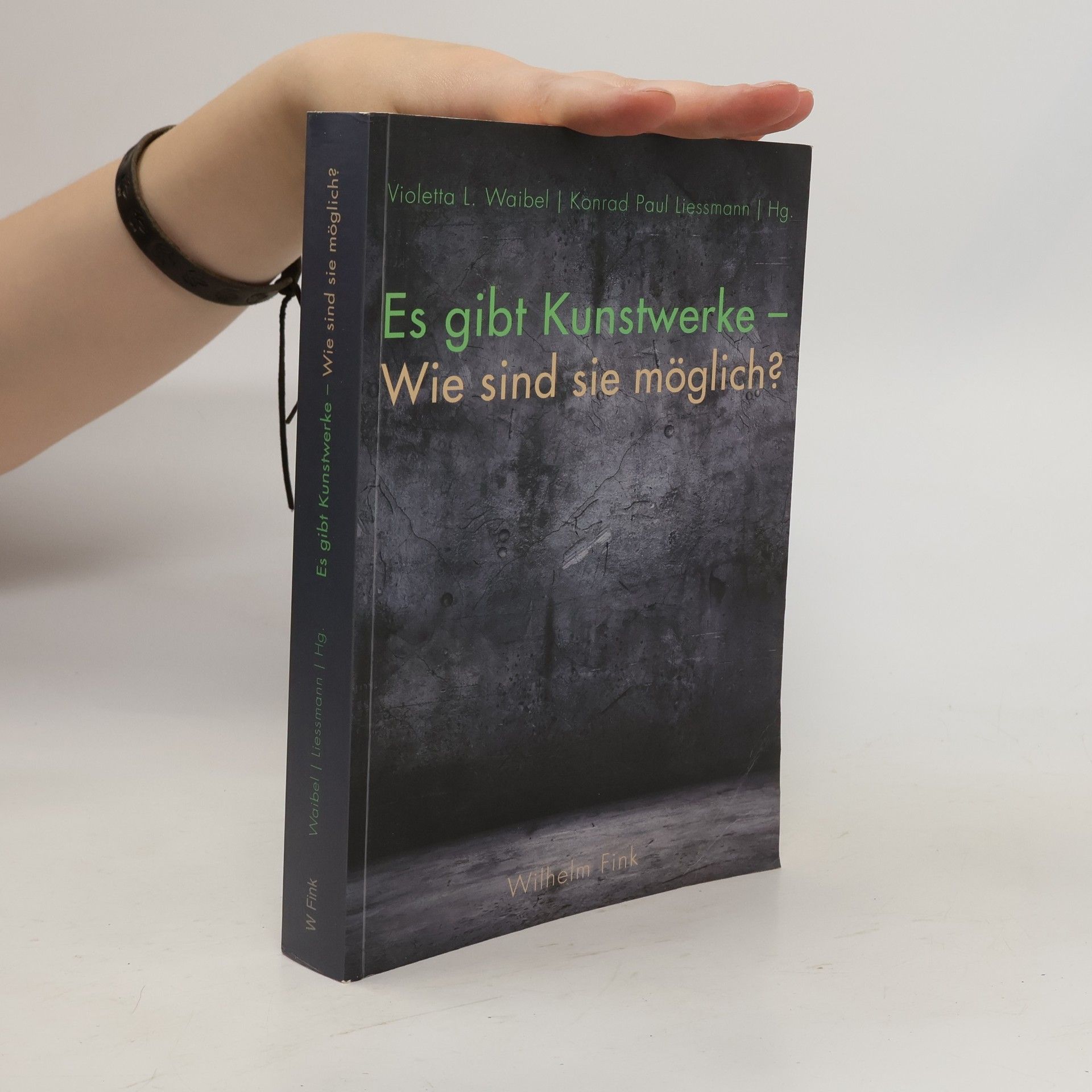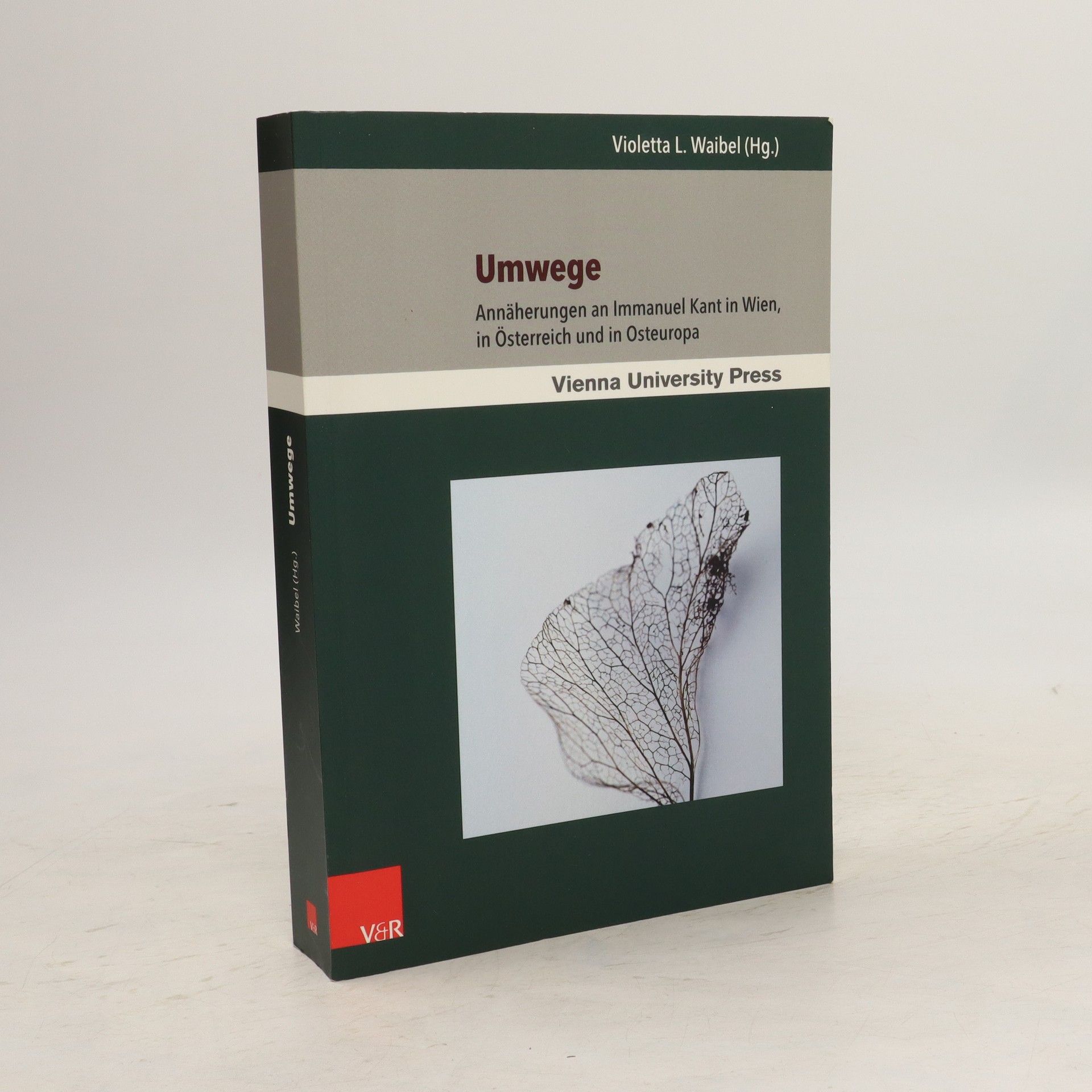Verwandlungen
Dichter als Leser Kants
Kant, the embodiment of Enlightenment, reason, and rationality, captivates writers, even as the dryness and rigor of his thought provoke resistance, whether justified or not. Schiller, Goethe, Hölderlin, Kleist, and Grillparzer have engaged with his ideas. Tolstoy and Dostoevsky have also creatively grappled with Kant's works, both directly and indirectly. Ironic figures like Falk, Bonaventura/Klingemann, Heine, and Bernhard were drawn to Kant's writings and persona, often using humor or spite to create distance. This volume explores the diverse literary appropriations of Kant, highlighting the various facets and transformations through which art interacts with him as a thinker.