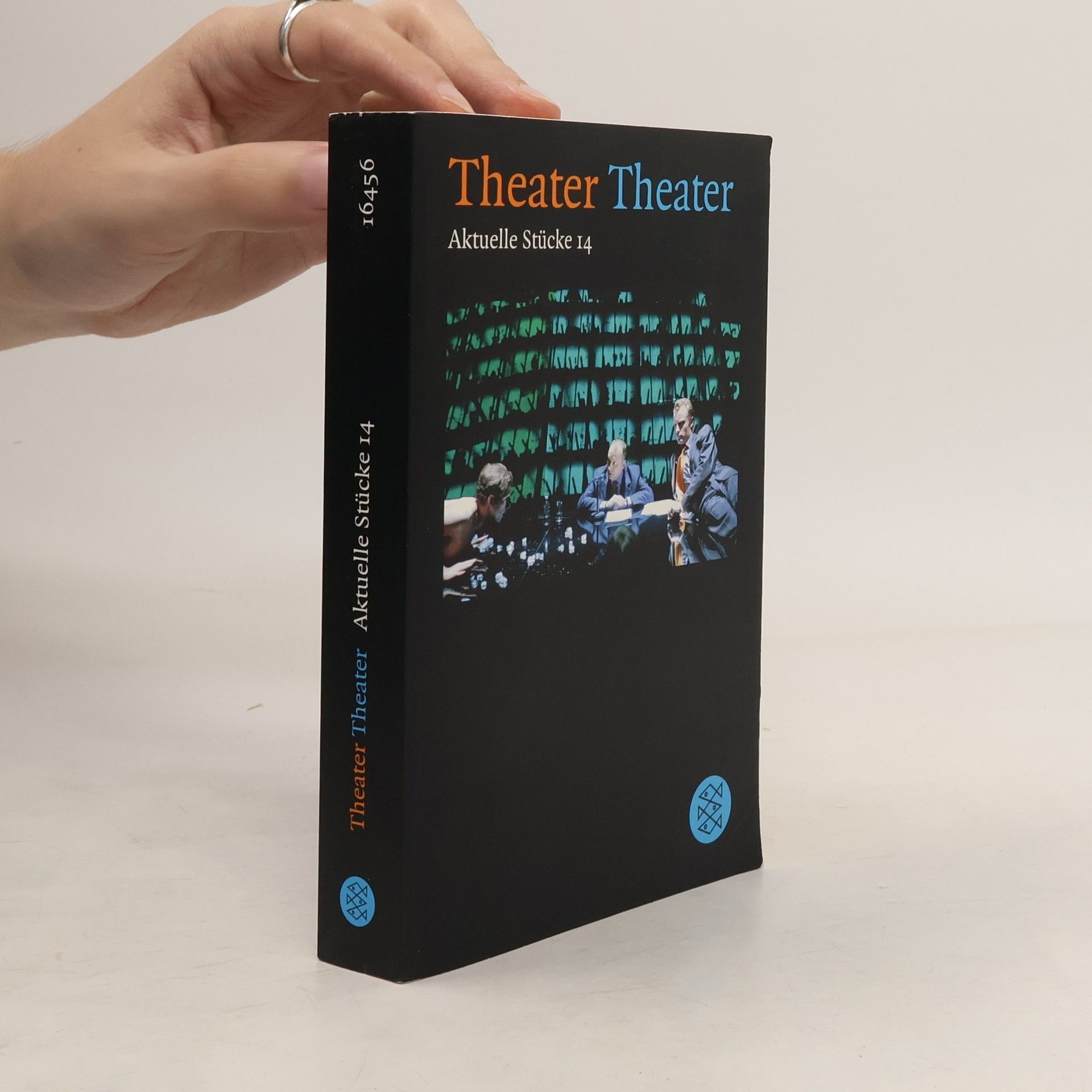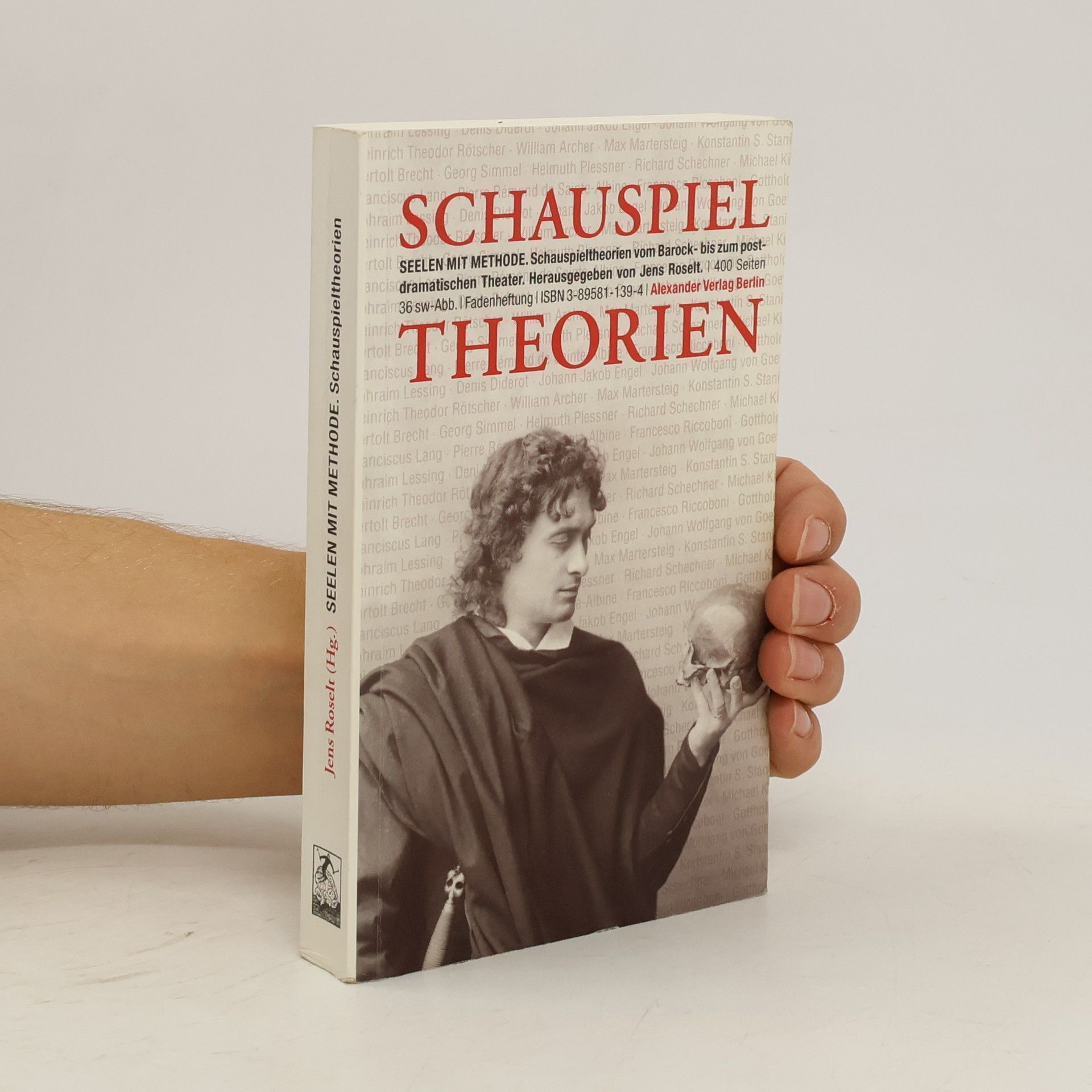Seelen mit Methode
Schauspieltheorien vom Barock bis zum postdramatischen Theater
- 395pages
- 14 heures de lecture
Ist Schauspielen eine Kunst? Schauspieler sind die Fixpunkte der Aufmerksamkeit im Theater, und seit dreihundert Jahren versuchen Theoretiker, schauspielerisches Handeln zu definieren. In den Schauspieltheorien wird untersucht, ob der Schauspieler sich selbst oder jemand anderen spielt, ob seine Gefühle echt oder vorgetäuscht sind, und wie er seinen Körper einsetzt. Welche geistigen und körperlichen Voraussetzungen sind nötig, und wie können diese geschult werden? Die Lektüre dieser Theorien bietet Einblicke in die Menschenbilder und Körperverständnisse, die zu verschiedenen Zeiten im Theater dargestellt wurden, und zeigt, wie diese Bilder immer wieder bestätigt, in Frage gestellt und erweitert wurden. Der Band versammelt zentrale schauspieltheoretische Texte vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die Theorien von Persönlichkeiten wie Franziscus Lang, Pierre Rémond de Sainte Albine, G. E. Lessing, Denis Diderot, Konstantin S. Stanislawski und Bertolt Brecht werden im historischen Kontext erläutert. Eine systematische Einführung bietet einen Überblick über zentrale Kategorien der Schauspielkunst wie Nachahmung, Verkörperung, Natürlichkeit und Emotionalität auf der Bühne.